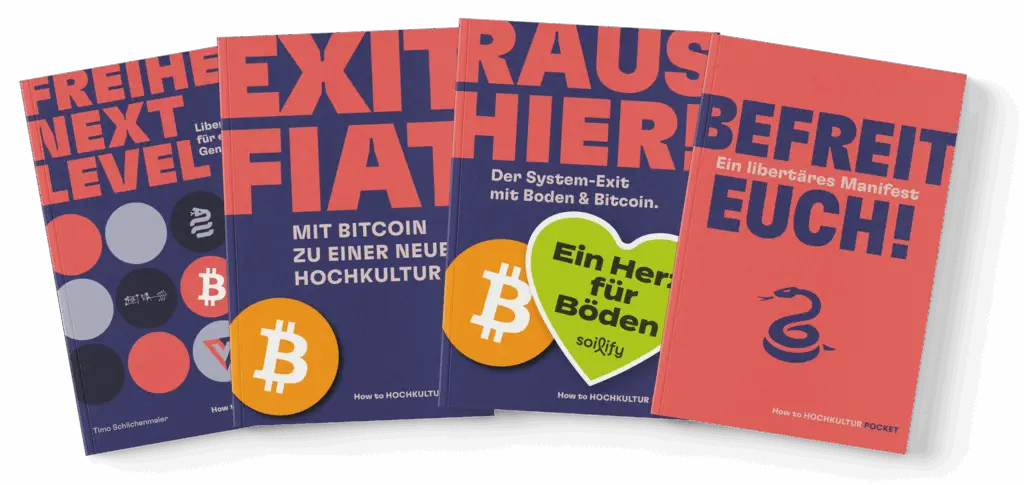Zwischen Projektion und Panik
Wer über Libertäre spricht, meint oft etwas völlig anderes.
Die einen denken an Amazon-Bosse, die keine Steuern zahlen wollen.
Die anderen an Prepper in Bunkern mit Bitcoin und Dosenravioli.
Und dann gibt es da Texte wie jenen auf Kontrapolis.info, in dem das Afuera-Festival in Regensburg zum Schmelztiegel von Neoliberalismus, Kapitalismus, Faschismus, Sexismus, Esoterik und Anarchokapitalismus erklärt wird – natürlich alles in einem Atemzug.
Was dabei herauskommt, ist eine Karikatur.
Und Karikaturen kann man nicht diskutieren – nur entlarven.
In diesem Text gehen wir 20 gängigen Mythen auf den Grund, die man in linken Kreisen über die Österreichische Schule, über Libertäre und über Anarchokapitalismus hört.
Einige davon sind Missverständnisse.
Andere bewusste Verdrehungen.
Und manche schlicht die Angst davor, was passiert, wenn Menschen plötzlich anfangen, selber zu denken – und zu handeln.
Alle 20 Mythen
Mythos 1: „Libertäre sind gegen Solidarität“
Behauptung: „Libertäre wollen keine Sozialleistungen. Sie sind gegen jede Form von Umverteilung. Ihnen ist das Schicksal Schwächerer egal. Solidarität ist für sie ein Schimpfwort.“
Fakt: Libertäre sind gegen Zwangssolidarität – nicht gegen Solidarität.
Echte Hilfe basiert auf Freiwilligkeit. Und nur dann ist sie moralisch wertvoll.
Solidarität ist ein schönes Wort. Es klingt nach Zusammenhalt, nach Füreinander-da-Sein.
Aber was ist sie noch wert, wenn sie vom Staat verordnet wird?
Libertäre unterscheiden strikt zwischen Freiwilligkeit und Zwang.
Solidarität, die unter Androhung von Strafe eingefordert wird – sei es durch Steuern, Sozialabgaben oder Enteignung – ist keine Tugend mehr. Sie ist ein Machtinstrument. Ein Euphemismus für Umverteilung mit der Pistole auf der Brust.
Das bedeutet nicht, dass Libertäre kaltherzig wären. Im Gegenteil.
Sie setzen auf freiwillige Hilfe, auf private Netzwerke, auf Nachbarschaft, Kirchen, Stiftungen, Crowdfunding, Communities. Dort entsteht Solidarität von unten – nicht von oben herab verordnet.
Und vor allem: zielgerichtet, effizient und menschlich.
Staatliche Umverteilung funktioniert selten so. Sie produziert riesige Bürokratien, bei denen von 100 € „Hilfe“ oft nur 30 € ankommen. Der Rest versickert in Verwaltungsapparaten, Beraterverträgen und politischem Taktieren.
Wer wirklich helfen will, braucht keine Zwangsmaschine.
Er braucht Herz, Verstand – und die Freiheit zu entscheiden.
Libertäre sagen: Zwang ist keine Liebe. Und kein Mitgefühl.
Mythos 2: „Die Österreichische Schule will das Recht des Stärkeren“
Behauptung: „In der Marktlogik der Österreichischen Schule setzt sich der Stärkere durch. Der Schwache bleibt auf der Strecke. Wettbewerb heißt eben: fressen oder gefressen werden.“
Fakt: Die Österreichische Schule verteidigt gerade das Recht des Schwächeren – durch klare Eigentumsrechte, freiwilligen Tausch und das strikte Verbot von Gewalt.
„Fressen oder gefressen werden“ gilt nicht auf freien Märkten – sondern im Dschungel ohne Eigentum und Recht.
Dieser Mythos ist beliebt – weil er sich so herrlich dramatisch anhört.
Ein bisschen wie ein Hollywood-Plot: Der böse Reiche, der alle verdrängt, und der naive Idealist, der mit Gitarre und Gerechtigkeit dagegenhält.
Aber die Realität ist viel banaler – und viel tiefgründiger.
Die Österreichische Schule (von Menger über Böhm-Bawerk bis Mises, Rothbard und Hoppe) beschreibt Märkte nicht als Krieg, sondern als Kooperationssystem.
Jeder profitiert – weil jeder freiwillig nur dann tauscht, wenn er etwas davon hat.
Es geht nicht ums Besiegen, sondern ums Dienen: Wer anderen besser dient, hat Erfolg. Punkt.
Was bedeutet das für „Stärke“?
Ein Konzern, der sich auf dem freien Markt behauptet, muss täglich neu beweisen, dass er Wert liefert.
Tut er das nicht – ist er weg vom Fenster.
Das ist kein Recht des Stärkeren, das ist das Recht des Kunden.
Und was schützt den Schwächeren, den kleinen Anbieter, den Einzelnen?
Eigentumsrechte.
Denn nur wer Eigentum hat, kann sich gegen Eingriffe wehren. Nur wer nicht enteignet wird, kann frei handeln. Die Österreichische Schule verteidigt genau das: das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Kein Konzern, kein Nachbar, kein Staat darf einfach nehmen, was ihm nicht gehört.
Wenn jemand mit Gewalt droht, ist das kein Marktversagen – sondern ein Bruch des zentralen Prinzips: Nicht-Aggression.
Ironischerweise ist es oft der Staat, der das „Recht des Stärkeren“ durchsetzt – nur nennt man es dann „Mehrheit“, „Gesetz“ oder „Gemeinwohl“.
Aber was ist das anderes als kollektiver Zwang gegen den Einzelnen?
Wer sich wirklich für die Schwachen einsetzt, verteidigt ihr Recht, selbst zu entscheiden, zu tauschen, zu leben.
Und das tut die Österreichische Schule – konsequenter als jede staatliche Ideologie.
Mythos 3: „Anarchokapitalismus ist keine echte Anarchie“
Behauptung: „Anarchokapitalismus ist ein Widerspruch in sich. Kapitalismus basiert auf Hierarchie, Privateigentum, Unterdrückung. Echte Anarchie lehnt all das ab.“
Fakt: Anarchokapitalismus ist die konsequenteste Form von Anarchie – weil er jede Herrschaft ablehnt, auch die staatliche. Er verteidigt Selbstbestimmung durch freiwillige Kooperation, Eigentum und das Gewaltverbot.
Was ist eigentlich Anarchie?
Viele stellen sich darunter brennende Mülltonnen vor, Straßenkämpfe und ein kollektives „No gods, no masters“-Gebrüll. Doch ursprünglich bedeutet Anarchie schlicht: Herrschaftslosigkeit. Keine zentrale Gewalt, kein Monopol auf Zwang. Keine Unterordnung unter „eine da oben“.
Das unterschreiben auch Anarchokapitalisten – und zwar bedingungslos.
Während linke Anarchisten oft sagen: „Keine Herrschaft… außer wir gemeinsam entscheiden, was richtig ist“, sagen AnCaps:
„Niemand darf dich zwingen – nicht mal im Namen des Guten.“
Und jetzt kommt der Reibungspunkt: Eigentum.
Linke Anarchisten sehen Privateigentum oft als Unterdrückung. Aber sie übersehen, dass Besitz in einer freien Gesellschaft nicht Unterdrückung ist, sondern Verantwortung.
Dein Körper gehört dir. Dein Haus auch. Dein Werkzeug, dein Laptop, dein Feld, dein Bitcoin – all das sind Erweiterungen deiner Person.
Ohne Eigentum ist alles kollektiv – was bedeutet, dass immer jemand entscheidet, wer was wann wie nutzen darf.
Also doch wieder Herrschaft. Meist von denen, die das größte Megafon haben.
Anarchokapitalisten sagen: Eigentum ist ein Schutzschild. Wer nicht will, dass dir jemand reinquatscht, braucht eine klare Grenze. Diese Grenze ist Eigentum.
Und wie regeln wir Konflikte?
Nicht durch eine Zentralgewalt – sondern durch freiwillige Schiedsstellen, Schutzanbieter, Versicherungen, Verträge. Klingt utopisch? Ist es vielleicht auch. Aber es ist freiwillig. Und das ist der Punkt.
Anarchokapitalismus ist also keine Verherrlichung von Konzernen oder Kapital, sondern eine Ethik der freiwilligen Ordnung – ohne Zwang, ohne Steuern, ohne Planwirtschaft. Eine Ordnung, die von unten wächst.
Kurz:
Linke Anarchie ist oft anti-hierarchisch, aber doch kollektivistisch.
Anarchokapitalismus ist anti-gewaltsam – und radikal individuell.
Beides sind Versuche, Herrschaft zu überwinden.
Aber nur einer tut es wirklich – bis zum Ende gedacht.
Mythos 4: „Libertäre hassen Gleichheit“
Behauptung: „Libertäre sind gegen Gleichheit. Sie verteidigen Ungleichheit, Reichtum, Macht. Ihnen geht es nur um Leistung, nicht um Gerechtigkeit.“
Fakt: Libertäre lehnen Gleichmacherei ab – nicht Gleichheit vor dem Recht.
Sie verteidigen Vielfalt, Individualität und das Recht, anders zu sein – nicht das staatlich verordnete Einheitsgrau.
Gleichheit ist ein mächtiges Wort.
Es klingt nach Fairness, nach Gerechtigkeit, nach Brüderlichkeit.
Aber es ist auch ein Wort, das – falsch verstanden – in den Totalitarismus führt.
Was meinen wir mit Gleichheit?
- Gleich vor dem Gesetz?
→ Ja, unbedingt. Jeder Mensch – ob arm oder reich, stark oder schwach – hat dieselben Rechte. Keine Sonderregeln. Keine Immunität. Keine Extrawürste.
- Gleich im Ergebnis?
→ Nein. Weil Menschen unterschiedlich sind – in ihren Talenten, Wünschen, Entscheidungen, ihrem Fleiß, ihrer Risikobereitschaft.
Und das ist gut so.
Die Österreichische Schule zeigt: Märkte sind gerade deshalb produktiv, weil sie auf Vielfalt beruhen. Jeder bringt etwas anderes ein, jeder entscheidet anders, jeder trägt andere Risiken. Das Ergebnis ist: Ungleichheit.
Aber nicht als Skandal – sondern als Ausdruck von Freiheit.
Wenn alle gleich gemacht werden sollen, braucht es eine Macht, die Gleichheit durchsetzt. Und diese Macht muss dann Ungleiches verbieten:
- Du darfst nicht mehr verdienen.
- Du darfst nicht anders leben.
- Du darfst nicht erfolgreicher sein.
Das Ergebnis ist nicht Gerechtigkeit – sondern Zwang.
Nicht Gleichheit – sondern Gleichschaltung.
Libertäre verteidigen das genaue Gegenteil:
Die Freiheit zur Ungleichheit.
Weil echte Gleichheit Freiheit voraussetzt – nicht Gleichmacherei.
In einer freien Gesellschaft darfst du reich werden, arm bleiben, alles geben oder nichts tun – solange du niemanden zwingst.
Und du darfst auch in einer Kommune leben, kollektiv wirtschaften, gemeinsam Eigentum teilen – solange alle freiwillig dabei sind.
Das ist keine soziale Kälte.
Das ist die wärmste Form von Respekt:
Du darfst anders sein.
Mythos 5: „Libertäre sind alle reich“
Behauptung: „Libertäre vertreten nur die Interessen der Reichen. Kein Wunder – sie sind ja selbst alle wohlhabend, privilegiert, abgehoben.“
Fakt: Die meisten Libertären sind nicht reich – sie sind nur nicht neidisch.
Sie setzen auf Eigenverantwortung statt Opferstatus, auf Produktivität statt Umverteilung. Reichtum ist kein Verbrechen – Zwang schon.
Das Bild vom libertären Yuppie ist beliebt:
Ein blondgelockter Egozentriker im Porsche, der Ayn Rand zitiert und auf Obdachlose herabblickt, während er seinen Steuerberater anruft.
Nur: Es hat mit der Realität von Libertären ungefähr so viel zu tun wie Karl Marx mit Blockchain.
Viele Libertäre leben ganz normal: als Selbstständige, Handwerker, Bauern, Künstler, Techniker, Entwickler, Lehrer, Journalisten, Buchautoren, Familienmenschen.
Was sie verbindet, ist nicht der Kontostand – sondern der Gedanke:
„Ich will mein Leben selbst gestalten – und dabei niemandem auf der Tasche liegen.“
Libertäre verteidigen nicht „die Reichen“, sondern die Freiheit aller Menschen, Wert zu schaffen, zu sparen, zu investieren, sich etwas aufzubauen – ohne vom Staat geplündert zu werden.
Sie sagen:
Wenn jemand durch freiwilligen Tausch, gute Ideen oder Fleiß reich wird – gut so!
Wenn jemand durch Korruption, Vetternwirtschaft, Subventionen oder Lobbyismus reich wird – Schluss damit!
Der Unterschied ist entscheidend:
Freie Märkte vs. Vetternwirtschaft.
Und die meisten echten Reichen heute profitieren nicht vom freien Markt – sondern von der Nähe zur Macht.
Von der EU, von der EZB, von der WHO, von der GIZ, von der öffentlichen Hand.
Das ist kein Kapitalismus – das ist Korporatismus.
Libertäre wollen keine „Herrschaft des Kapitals“.
Sie wollen die Abschaffung aller Herrschaft.
Auch der finanziellen, die mit staatlicher Hilfe zementiert wird.
Und dass viele Libertäre gut wirtschaften, liegt schlicht daran, dass sie gelernt haben, was Geld ist – und wie man es nicht durch Inflation zerstören lässt.
Sie bauen Bitcoin-Nodes statt Dispo-Kredite.
Sie kaufen Saatgut statt Gender-Lehrstühle.
Sie investieren in sich selbst – nicht in das nächste Förderprojekt.
Kurz gesagt:
Libertäre sind nicht reich – sie sind wach.
Und das ist viel gefährlicher für das System.
Mythos 6: „Libertäre sind alle rechts“
Behauptung: „Libertäre sind verkappte Rechte. Sie tarnen ihren Egoismus als Freiheitsliebe, aber in Wahrheit stehen sie ideologisch ganz weit rechts.“
Fakt: Libertäre stehen weder rechts noch links – sie stehen außerhalb.
Sie lehnen jede Form von Zwangsherrschaft ab: die rechte wie die linke, die wirtschaftliche wie die kulturelle. Sie sind nicht konservativ, sondern radikal freiheitlich.
Links und rechts – dieses Koordinatensystem stammt aus dem 18. Jahrhundert, als im französischen Parlament Royalisten rechts und Republikaner links saßen.
Und bis heute tun wir so, als wäre das die einzig denkbare Achse politischer Ordnung.
Aber was, wenn die Wahrheit ganz woanders liegt?
Libertäre sagen: Die entscheidende Achse ist nicht links gegen rechts, sondern:
Freiwilligkeit vs. Zwang.
Links wie rechts haben in der Geschichte Zwangssysteme errichtet:
- Der Kommunismus enteignete im Namen der Gleichheit.
- Der Faschismus unterdrückte im Namen der Nation.
- Der Sozialstaat heute reguliert im Namen der Gerechtigkeit.
- Und der Überwachungsstaat kontrolliert im Namen der Sicherheit.
Libertäre hingegen fragen:
Wer hat das Recht, dich zu zwingen?
Die Antwort ist: Niemand.
Sie verteidigen Meinungsfreiheit – auch für Menschen, mit denen sie nicht übereinstimmen.
Sie lehnen jeden Krieg ab – ob im Namen des Vaterlands oder der Menschenrechte.
Sie fordern Selbstbestimmung – beim Geld, bei der Medizin, bei der Bildung, bei der Kultur.
Und ja, das kann für Linke irritierend sein.
Denn Libertäre sind für radikale Dezentralisierung.
Sie vertrauen nicht dem Staat, nicht der UNO, nicht den NGOs.
Sie glauben nicht an Kollektive, sondern an Individuen.
Aber sie sind nicht konservativ.
Im Gegenteil: Viele Libertäre leben polyamor, queer, psychedelisch, spirituell, naturverbunden, digital-nomadisch, anarchisch und offen für neue Ideen.
Sie wählen nicht AfD. Sie wählen gar nicht.
Denn sie haben verstanden:
Wahlen ändern das Personal – nicht die Strukturen.
Wer also meint, Libertäre seien „rechts“, hat die politische Debatte auf Twitter-Niveau reduziert:
Wer nicht für uns ist, ist rechts.
Das ist nicht Analyse. Das ist Projektion.
Libertäre sagen: „Weder links noch rechts – sondern frei.“
Und das ist das wahre Extrem: Radikale Selbstverantwortung.
Mythos 7: „Libertär ist ein rechter Kampfbegriff“
Behauptung: „Der Begriff ‚libertär‘ wurde von der Rechten gekapert, um ihren Kapitalismus zu tarnen. Früher war das ein linker Begriff – heute ist er nur noch ein Feigenblatt für Egoismus.“
Fakt: „Libertär“ war ursprünglich links – wurde aber von den Linken verlassen, als sie sich für Zwang begeisterten.
Libertäre haben den Begriff nicht geklaut, sondern gerettet.
Das Wort „libertär“ stammt vom französischen libertaire und wurde im 19. Jahrhundert von linken Anarchisten wie Joseph Déjacque benutzt – als Alternative zum Begriff „liberal“, der damals schon mit wirtschaftlichem Bürgertum assoziiert war.
Déjacque war ein entschiedener Gegner von Eigentum, aber auch von Hierarchie, Staat und Kirche – ein radikaler Denker, der sogar Proudhon zu zahm fand.
Sein „Libertarismus“ war eine Art frühsozialistische, staatsfeindliche Vision des freien Menschen.
Aber was passierte dann?
Die Linke – vor allem nach Marx – begann zunehmend, den Staat als Werkzeug zur „Befreiung“ zu begreifen.
Die ursprünglichen anarchistischen Impulse wurden von der Idee der Planwirtschaft und der Diktatur des Proletariats überlagert.
Freiheit wurde zugunsten von „sozialer Gerechtigkeit“ geopfert.
Und plötzlich war das Wort „libertär“ für viele Linke unbrauchbar geworden – zu individualistisch, zu marktfreundlich, zu wenig revolutionär.
Hier kamen Denker wie Murray Rothbard ins Spiel. Sie sagten:
Moment – wir sind die wahren Gegner von Herrschaft.
Nicht ihr mit euren Steuern, Subventionen und zentralisierten Gesellschaftsmodellen.
Wir wollen eine Welt ohne Zwang – also ohne Staat, ohne Monopole, ohne Gewalt.
Sie griffen den Begriff „libertär“ wieder auf – nicht als Etikettenschwindel, sondern als logische Konsequenz.
Denn:
Was ist „libertär“, wenn nicht das kompromisslose Eintreten für das Recht auf Selbstbestimmung, Eigentum und freiwilligen Austausch?
Heute ist der Begriff deshalb umkämpft.
Die Linke wirft den Libertären „Kaperung“ vor – dabei hat sie das Schiff längst selbst verlassen.
Sie steht lieber am sicheren Kai des Wohlfahrtsstaates und ruft: „Falsche Segel!“
Doch die Wahrheit ist:
Der Begriff „libertär“ ist kein rechter Kampfbegriff – sondern ein freier Begriff, der sich geweigert hat, zum Knecht staatlicher Macht zu werden.
Er gehört niemandem – aber er bedeutet etwas.
Und wer ihn benutzt, sollte wissen:
Er verpflichtet zur radikalsten aller Haltungen: Lass die Menschen in Ruhe.
Mythos 8: „Mises und Hayek sind Neoliberale“
Behauptung: „Die Österreichische Schule ist der Ursprung des Neoliberalismus. Hayek und Mises haben die Ausbeutungsmaschine des globalen Kapitalismus legitimiert.“
Fakt: Hayek und Mises waren radikale Kritiker staatlicher Macht und Gegner jeder Konzern-Staats-Kumpanei.
Sie haben freien Tausch verteidigt – nicht den heutigen Lobbyismus-Kapitalismus. Der Neoliberalismus hat ihre Ideen entstellt, nicht umgesetzt.
Wenn jemand „Neoliberalismus“ sagt, klingt das heute nach:
- Hedgefonds
- Sozialabbau
- Steuertricks
- Globalisierung
- Rentenkürzung
- Amazon Prime im Namen der Freiheit™
Und dann sagt man: „Daran sind Mises und Hayek schuld.“
Aber das ist in etwa so, als würde man Jesus für die Inquisition oder Darwin für Rassismus verantwortlich machen.
Was war wirklich?
Ludwig von Mises war ein kompromissloser Gegner jeder staatlichen Planwirtschaft.
Sein berühmter Beitrag war: Der Sozialismus scheitert, weil er keine Preise kennt. Ohne freie Preise gibt es keine wirtschaftliche Rationalität – also auch keine vernünftige Verteilung von Ressourcen.
Friedrich August von Hayek, sein Schüler, war vorsichtiger im Ton, aber nicht weniger klar:
Wissen ist dezentral, Planung ist Anmaßung, Freiheit braucht ein System, das niemand beherrscht.
Und jetzt kommt der Knick:
In den 1970ern wurde in Europa und Amerika der Begriff „Neoliberalismus“ wiederbelebt – angeblich als Alternative zum Keynesianismus.
Aber was kam, war kein echter Markt – sondern ein Staats-Konzern-Komplex:
- Banken wurden „gerettet“.
- Monopole wurden durch Regulierung geschützt.
- Geld wurde zentral „gesteuert“.
- Politisch vernetzte Unternehmen kassierten Subventionen.
- Globalisierung wurde zur Einbahnstraße der Auslagerung.
Das alles hätten Hayek und Mises abgelehnt.
- Hayek war gegen Papiergeld und Zentralbanken.
- Mises war für radikale Trennung von Staat und Wirtschaft.
- Rothbard – als Erbe beider – wollte den Staat komplett abschaffen.
Der Neoliberalismus dagegen ist eine Chimäre:
Er redet vom Markt – aber lebt vom Staat.
Er ruft „Wettbewerb“ – aber meint Kartell.
Er verkauft Freihandel – und liefert Machtkonzentration.
Die Österreichische Schule ist keine Apologie des Status quo – sie ist ein Sprengsatz darunter.
Ihr Ideal ist nicht Davos – sondern Dezentralität.
Nicht BlackRock – sondern der kleine Bäcker, der ohne Genehmigung sein Brot verkauft.
Kurz gesagt:
Wenn du Hayek „Neoliberalismus“ vorwirfst, hast du ihn nie gelesen.
Oder: du willst ihn nicht verstehen – weil du zu sehr vom Staat profitierst.
Mythos 9: „Die Österreichische Schule ist gegen Demokratie“
Behauptung: „Libertäre sind antidemokratisch. Sie wollen keine Mehrheitsentscheidungen, sondern eine Herrschaft des Kapitals. Das ist gefährlich und rückschrittlich.“
Fakt: Die Österreichische Schule kritisiert Demokratie nur dort, wo sie zum Zwangsinstrument wird.
Freiheit bedeutet: Niemand darf dich unterdrücken – auch keine Mehrheit.
Demokratie ist ein heiliger Begriff.
Wer sie kritisiert, steht schnell unter Verdacht, ein Feind der Zivilisation zu sein – oder mindestens ein Nazi.
Aber was ist Demokratie wirklich?
Rein technisch: Herrschaft der Mehrheit.
Und das klingt erstmal gut – bis du zur Minderheit wirst.
Was, wenn 51 % deiner Nachbarn beschließen, dass du:
- dein Haus nicht mehr verkaufen darfst?
- keine Rohmilch trinken darfst?
- dein Kind nicht mehr selbst unterrichten darfst?
- dein Einkommen offenlegen musst?
- dein Geld in einer staatlichen App halten sollst?
Willkommen in der Demokratie.
Die Österreichische Schule – insbesondere in ihren libertären Ausprägungen – stellt eine unangenehme, aber fundamentale Frage:
Darf die Mehrheit dich zwingen?
Wenn du niemandem schadest? Wenn du einfach nur anders lebst?
Die Antwort ist klar: Nein.
Libertäre sehen Demokratie nicht als höchsten Wert, sondern als ein Verfahren.
Ein Verfahren, das manchmal nützlich sein kann – aber kein Freifahrtschein für kollektiven Machtmissbrauch ist.
Freiheit bedeutet:
Du darfst leben, wie du willst – egal ob die Mehrheit das gut findet oder nicht.
Du brauchst keine Erlaubnis, um Mensch zu sein.
Und du bist nicht der Spielball eines politischen Wettrennens.
Übrigens: Die radikale Kritik an Demokratie als Mehrheitszwang kommt nicht von „rechts“.
Sie kommt von Lysander Spooner, einem Anti-Sklaverei-Aktivisten, radikalen Pazifisten und anarchistischen Denker des 19. Jahrhunderts.
Er schrieb:
„Die Verfassung hat entweder die Regierung ermöglicht, die wir haben – oder war machtlos, sie zu verhindern.“
Demokratie schützt keine Freiheit – wenn sie Eigentum nicht respektiert.
Denn ohne Eigentum ist jede Entscheidung politisch. Und das ist der Weg in den Totalstaat.
Die Österreichische Schule sagt daher:
- Ja zu freiwilligen Gemeinschaften.
- Ja zu Abstimmungen – in Vereinen, auf Grundstücken, in Parallelgesellschaften.
- Nein zur Zwangsdemokratie, bei der du nicht aussteigen darfst.
Oder in einem Satz:
Freiheit ist, wenn du „Nein“ sagen darfst – auch zur Mehrheit.
Mythos 10: „Libertäre wollen alles privatisieren – auch Polizei und Justiz!“
Behauptung: „Anarchokapitalisten wollen Polizei, Gerichte und das Gewaltmonopol privatisieren. Das führt zu Söldnerstaaten, Gated Communities, Lynchjustiz und Chaos.“
Fakt: Libertäre wollen kein Gewaltmonopol – weder staatlich noch privat.
Sie wollen Wettbewerb bei Schutz und Recht – auf Basis von Freiwilligkeit und Eigentum. Nicht weniger Ordnung, sondern bessere Ordnung.
Der Vorwurf kommt schnell:
„Wie soll das gehen, ohne Polizei? Ohne Richter? Ohne Gesetz? Dann herrscht doch der Stärkere!“
Aber Moment.
Wer herrscht denn jetzt?
Die Polizei hat in fast allen Ländern ein Zwangsmonopol.
Wenn sie dich falsch behandelt, bleibt dir:
- ein interner Beschwerdebrief,
- ein sehr teurer Anwalt,
- oder eine Demo mit Schildern.
Und wer definiert das „Gesetz“?
Nicht du. Nicht deine Familie. Nicht dein Dorf.
Sondern ein Parlament, das du alle vier Jahre ankreuzen darfst – in einem Spiel, das längst andere Regeln hat.
Die Österreichische Schule – allen voran Murray Rothbard und später Hans-Hermann Hoppe – stellt die Frage:
Warum soll ausgerechnet Schutz vor Gewalt ein Monopol sein?
Warum sollten die mit den Waffen gleichzeitig die einzigen sein, die über ihre eigene Rechtmäßigkeit urteilen?
Wäre das bei anderen Dienstleistungen auch akzeptabel?
Stell dir vor:
- Es gäbe nur einen Automechaniker – vom Staat.
- Einen Bäcker – staatlich zertifiziert.
- Eine Zeitung – offiziell genehmigt.
- Und wenn du dich beschwerst: Pech. Ist Gesetz.
Niemand würde das akzeptieren.
Aber bei Justiz und Polizei: Doch?
Libertäre schlagen etwas anderes vor:
Schutzdienstleister in Konkurrenz.
Wie Versicherungen – nur für Sicherheit.
- Du wählst, wen du bezahlst.
- Du wählst, welche Regeln gelten sollen – per Vertrag.
- Konflikte werden durch Schiedsgerichte geregelt, auf die sich beide Parteien vorab geeinigt haben.
Das ist kein Fantasieprodukt – das gab es schon:
- In Island: mittelalterliche Rechtsgesellschaft ohne Zentralstaat.
- In Somalia (vor der UN-Intervention): funktionierende Clan-Gerichtsbarkeit.
- In Teilen der Schweiz: bis heute freiwillige Schlichtungsgemeinschaften.
- Und ganz modern: Bitcoin-Schiedsgerichte, Web3-Verträge, digitale Mediationsplattformen.
Ja, es ist ungewohnt.
Aber ungewohnt ist nicht gleich gefährlich.
Gefährlich ist: ein Monopol, das du nicht kündigen kannst.
Ein Staat, der entscheidet, wann du ein „Extremist“ bist – und dich dann „legal“ verfolgt.
Privatisierung heißt für Libertäre nicht: Konzern statt Staat.
Sondern: Wettbewerb statt Zwang.
Ordnung, weil sie gewollt ist – nicht, weil sie diktiert wird.
Oder wie Hoppe sagt:
„Ein Monopol auf Recht und Schutz wird immer zur Ungerechtigkeit führen – weil es keine Instanz mehr gibt, die es kontrollieren kann.“
Mythos 11: „Ohne Staat gäbe es keine Regeln“
Behauptung: „Ohne eine zentrale Autorität würde das Gesetz des Dschungels herrschen. Es gäbe keine Regeln, keine Verträge, keine Ordnung – nur Chaos.“
Fakt: Regeln entstehen nicht durch Herrschaft, sondern durch Zusammenleben.
Menschen entwickeln freiwillige Normen – überall dort, wo sie miteinander auskommen müssen. Der Staat ist dabei meist der Spätzünder, nicht der Urheber.
„Ohne Staat keine Regeln“ – das klingt logisch.
So logisch wie: „Ohne Lehrer kein Lernen.“ Oder: „Ohne Polizei kein Anstand.“
Aber stimmt das?
Beobachte mal ein paar Kinder auf einem Spielplatz.
Innerhalb von Minuten entstehen Regeln:
- Wer ist dran?
- Wie wird geschummelt?
- Was ist unfair?
- Wer wird gemieden, weil er nervt?
Und das alles ohne Gesetzbuch, ohne Polizei, ohne Justizministerium.
Denn wo Menschen aufeinandertreffen, brauchen sie Strukturen – und sie entwickeln sie selbst.
Dasselbe gilt für Märkte, Dörfer, Netzwerke, Gemeinschaften:
- Händler einigen sich auf Maße und Gewichte.
- Bauern klären Wasserrechte.
- Nachbarn verabreden Ruhezeiten.
- Digitale Plattformen regeln Verhalten über Nutzungsbedingungen.
Und all das funktioniert besser, wenn es freiwillig und konkurrenzfähig ist.
Der Staat dagegen neigt dazu, Regeln aufzuzwingen, die:
- gar nicht zur konkreten Situation passen,
- durch Lobbygruppen beeinflusst wurden,
- Bürokratie statt Gerechtigkeit erzeugen.
Libertäre sagen:
Regeln braucht es – aber nicht von oben.
- Schiedsgerichte statt Amtsgerichte.
- Verträge statt Gesetze.
- Peer Pressure statt Polizei.
Historisch betrachtet ist es sogar so, dass erst Regeln da waren – und dann der Staat kam, um sie zu monopolisieren.
- Die Lex Mercatoria (Handelsrecht) war vorstaatlich.
- Gewohnheitsrecht entstand ohne Gesetzgeber.
- Eigentumsgrenzen wurden über Generationen vereinbart – nicht verordnet.
Und: Auch Staaten halten sich oft selbst nicht an ihre Regeln.
Sie brechen Verträge, retten „systemrelevante“ Freunde, ändern Gesetze nach Bedarf.
Der Libertarismus sagt daher:
- Ja zu Regeln.
- Nein zur Regelgewalt.
- Ja zur Ordnung – aber organisch gewachsen, nicht autoritär verhängt.
Oder wie Friedrich Hayek schrieb:
„Die Ordnung, die nicht des Menschen Entwurf ist, sondern das Ergebnis menschlichen Handelns – das ist die wirkliche Zivilisation.“
Mythos 12: „Anarchokapitalismus führt zu Konzernmacht“
Behauptung: „Ohne staatliche Kontrolle übernehmen Großkonzerne alles. Amazon, Nestlé, BlackRock – sie würden das Sagen haben. Anarchokapitalismus ist die Herrschaft der Megakonzerne.“
Fakt: Monopole entstehen nicht auf freien Märkten – sondern durch staatliche Privilegien, Patente, Subventionen, Lobbyismus und Regulierungskartelle.
Ohne Staat wären viele Konzerne gar nicht überlebensfähig.
Es klingt auf den ersten Blick plausibel:
Wenn der Staat sich zurückzieht, kommen die Haifische. Dann bestimmt das Geld alles. Dann herrschen die Bosse.
Aber wer sich anschaut, wie diese Konzerne überhaupt so groß geworden sind, entdeckt schnell: Ohne den Staat wären sie nichts.
Beispiele gefällig?
- BlackRock verwaltet Billionen – größtenteils staatlich gelenkte Renten- und Pensionsfonds.
- Nestlé kauft Wasserechte – oft mit Hilfe korrupter Lokalpolitiker und staatlicher Konzessionen.
- Amazon nutzt milliardenschwere Steuerschlupflöcher, Subventionen für Logistikzentren und staatlich regulierte Infrastruktur.
- Bayer-Monsanto lebt von Patentschutz und staatlicher Zulassungspolitik, nicht von freiem Wettbewerb.
- Facebook & Google wurden groß durch staatlich garantierten Netzausbau und Datendeals mit Behörden.
Die Wahrheit ist:
Ohne Staat wären diese Unternehmen viel kleiner, angreifbarer – und austauschbarer.
Denn in einem echten freien Markt gilt:
- Es gibt keine Lizenzpflichten.
- Keine regulatorischen Markteintrittsbarrieren.
- Keine Rettungspakete.
- Kein Zentralbankgeld, das Spekulation begünstigt.
Das bedeutet: echter Wettbewerb. Und der ist der natürliche Feind jeder Konzernmacht.
Außerdem:
Kunden sind frei, Alternativen zu wählen.
Investoren sind frei, neue Firmen zu finanzieren.
Innovationen sind frei, sich durchzusetzen – ohne politisches Vitamin B.
Libertäre sagen:
Nicht der Markt schafft Monster – sondern der Staat.
Die größte Konzernmacht ist nicht kapitalistisch – sondern korrumpiert.
Sie wächst in Symbiose mit Bürokratie, Vorschriften, Handelsabkommen und IWF-Krediten.
Und was ist die Lösung?
Mehr Freiheit – nicht weniger.
Mehr freie Entscheidungen, mehr Dezentralität, mehr regionale Initiativen, mehr Bitcoin, mehr DAO, mehr Peer-to-Peer.
Ein Konzern, der aufhört zu dienen, verliert in einem freien Markt seine Kunden.
Ein Staat, der aufhört zu dienen, erhöht die Steuern.
Das ist der Unterschied.
Mythos 13: „Libertäre wollen kein öffentliches Gut finanzieren“
Behauptung: „Ohne Steuern gäbe es keine Straßen, keine Feuerwehr, keine Bildung, kein Internet. Libertäre profitieren von öffentlichen Gütern, aber wollen sich nicht daran beteiligen. Das ist asozial.“
Fakt: Libertäre lehnen Zwangsfinanzierung ab – nicht gemeinsame Projekte.
Sie setzen auf Freiwilligkeit, Wettbewerb und Innovation – auch bei Infrastruktur. Viele „öffentliche Güter“ funktionieren sogar besser ohne Staat.
Dieser Mythos wirkt deshalb so stark, weil er an ein tief verankertes Schulbuchbild andockt:
- Öffentliche Güter sind wie Laternen – jeder braucht sie, keiner zahlt freiwillig.
- Ergo: Der Staat muss sie finanzieren – mit Steuern.
- Ergo: Wer gegen Steuern ist, ist gegen Straßenlaternen.
Aber ist das logisch?
Nehmen wir ein Beispiel: Straßen.
Wusstest du, dass ein Großteil des weltweiten Straßennetzes privat gebaut wurde?
- In den USA im 19. Jahrhundert: Private Mautstraßen, finanziert durch Anleihen.
- In Japan heute: Privatbetriebene Autobahnen mit innovativer Mauttechnologie.
- In Städten: Tiefgaragen, Zufahrten, sogar Brücken – privat gebaut, öffentlich genutzt.
Oder Bildung:
- Homeschooling, freie Schulen, Montessori, digitale Lernplattformen – oft erfolgreicher und günstiger als staatliche Systeme.
- Viele Libertäre sind selbst aktive Bildungsunternehmer. Sie bauen Alternativen, anstatt über Schulpolitik zu jammern.
Oder Feuerwehr:
- Freiwillige Feuerwehren sind das beste Beispiel: Ehrenamtlich, lokal organisiert, ohne Zwangsabgaben – und hoch effektiv.
- In den USA gibt es sogar privat versicherte Brandschutzdienste, die schnell und individuell helfen – ohne Beamtenlaufbahn.
Und dann: Das Internet.
Kein „staatliches Gut“, sondern das Ergebnis dezentraler Kooperation von Universitäten, Unternehmen und Nerds.
Ja, ARPA legte ein Protokoll – aber die eigentliche Explosion war nichtstaatlich.
Open Source, Foren, Start-ups, Netzwerke – public without being state-owned.
Libertäre sagen nicht: „Es darf keine Straßen geben.“
Sie sagen:
„Wenn etwas gebraucht wird, wird es finanziert – freiwillig, dezentral, effizient.“
Und wenn es nicht gebraucht wird? Dann ist es gut, dass niemand dazu gezwungen wurde.
Heute existieren moderne Möglichkeiten wie:
- Crowdfunding
- Mitgliedsmodelle
- Bitcoin-Spenden
- Micropayments über Lightning
- DAOs, Stiftungen, Plattformkooperationen
Wir leben im Zeitalter freiwilliger, digitaler Koordination.
Die Behauptung, nur der Staat könne sowas organisieren, ist 1940er-Denken.
Mit Faxgerät und Beamtendeutsch.
Libertäre sagen:
Gemeinsames Gut – ja. Gemeinsamer Zwang – nein.
Und das macht den Unterschied.
Mythos 14: „Der Markt zerstört Umwelt und Klima“
Behauptung: „Kapitalismus beutet Natur und Menschen aus. Der Markt kennt nur Profit. Ohne staatliche Regulierung und Klimapolitik wird die Erde unbewohnbar.“
Fakt: Der Markt belohnt verantwortliches Handeln – wenn Eigentum geschützt und Preise nicht manipuliert werden.
Staaten hingegen subventionieren Umweltschäden, verschleiern Kosten und fördern kurzfristige Ausbeutung. Eigentum schafft Verantwortung – Planwirtschaft zerstört sie.
„Der Kapitalismus zerstört die Welt“ – das steht auf vielen Transparenten.
Meist getragen von Leuten in synthetischer Outdoor-Kleidung, mit Smartphones aus Kinderarbeit und Bio-Apfelsaft vom subventionierten EU-Bauern.
Aber lassen wir Polemik – schauen wir auf Prinzipien:
Der Markt funktioniert nach dem Anreizprinzip.
Wer knappe Ressourcen gut einsetzt, wird belohnt. Wer sie verschwendet, verliert.
Aber dieser Mechanismus funktioniert nur, wenn zwei Dinge gewährleistet sind:
Klare Eigentumsrechte
Unverzerrte Preise
Was passiert, wenn beides fehlt?
→ Niemand ist verantwortlich – und alle greifen zu.
Der klassische Fall: Allmendeproblem.
Ob bei Überfischung, Abholzung oder Vermüllung – immer dann, wenn niemand zuständig ist, wird die Umwelt geschädigt.
Was passiert dagegen mit klarem Eigentum?
→ Der Besitzer hat einen Anreiz, langfristig zu denken.
Er pflegt den Wald, weil er von ihm lebt.
Er schützt das Wasser, weil er es braucht.
Er baut den Boden auf, weil seine Erträge sonst sinken.
Das gilt für Bauern, Forstwirte, Fischer – aber auch für neue Modelle wie Holistic Management, Regenerative Agriculture oder Permakultur.
Diese Bewegungen entstehen nicht aus Gesetzen – sondern aus echter Verantwortung.
Und aus der Erkenntnis: Gesunde Natur = nachhaltige Rendite.
Und was macht der Staat?
- Er subventioniert Monokulturen.
- Er zahlt für Massentierhaltung.
- Er stützt Agrarkonzerne.
- Er verbietet lokale Alternativen.
- Er lässt Böden verarmen – und rechnet das nicht mit ein.
- Er propagiert „CO₂-Zertifikate“ – moderne Ablassbriefe, die nichts lösen.
Klimapolitik wird so zum bürokratischen Ablasshandel, der globale Konzerne schützt und kleine Initiativen stranguliert.
Die Österreichische Schule sagt:
Die beste Umweltpolitik ist eine Politik des verantwortlichen Eigentums.
- Wer Eigentum hat, schützt es.
- Wer für seine Verschmutzung haftet, denkt zweimal nach.
- Wer keine Subventionen kriegt, muss effizient wirtschaften – nicht verschwenden.
Und mit Bitcoin als freiem Geld kommen langfristige Entscheidungen wieder in Mode:
- Energieverbrauch wird effizienter.
- Inflation fällt weg – also auch die Wachstumsobsession.
- Und Investitionen lohnen sich über Jahrzehnte, nicht nur bis zur nächsten Wahl.
Kurz:
Nicht der Markt zerstört die Umwelt – sondern das staatlich verzerrte Spiel mit falschen Preisen, falschen Anreizen und falscher Verantwortung.
Wer die Erde retten will, sollte nicht Greta zitieren – sondern Rothbard lesen.
Mythos 15: „Geld regiert die Welt – also ist Kapitalismus schuld“
Behauptung: „Alles dreht sich nur ums Geld. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Kapitalismus ist eine Geldmaschine für Eliten – und alle anderen verlieren.“
Fakt: Nicht „Geld“ regiert die Welt – sondern das staatliche Geldsystem.
Fiatgeld ist Zwangsgeld. Es ermöglicht Umverteilung, Spekulation, Schuldenwahn und künstliches Wachstum.
Freie Märkte funktionieren nur mit freiem Geld – wie Bitcoin.
Wenn Menschen über Kapitalismus schimpfen, meinen sie meist:
- Immobilienspekulation
- Börsen-Casinos
- ungedeckte Kredite
- explodierende Mieten
- stagnierende Löhne
- Konsumdruck
- Umweltzerstörung
- Burnout
Aber niemand fragt:
Was haben all diese Probleme gemeinsam?
Antwort: Das Geldsystem.
Seit 1971 leben wir weltweit in einem Fiatgeldregime – ein System, in dem Geld nicht mehr durch reale Werte gedeckt ist, sondern aus dem Nichts erzeugt werden kann.
Zentralbanken steuern Zinsen, drucken Billionen, manipulieren Märkte.
Staaten verschulden sich grenzenlos – und wälzen die Kosten auf zukünftige Generationen ab.
Dieses System:
- enteignet Sparer
- begünstigt Schulden
- macht langfristiges Denken unattraktiv
- fördert Konsum und Spekulation
- zerstört echte Preisfindung
- konzentriert Kapital bei den Ersten, die ans neue Geld kommen (Cantillon-Effekt)
Das ist kein Kapitalismus.
Das ist monetärer Feudalismus – mit der Zentralbank als Königshof und den Bürgern als steuerpflichtige Leibeigene.
Die Österreichische Schule – von Menger über Mises bis Rothbard – hat das früh erkannt.
Sie sagt:
„Geld ist keine staatliche Erfindung – es ist ein spontanes Produkt des Marktes.“
Geld muss:
- knapp sein
- teilbar
- übertragbar
- haltbar
- und frei wählbar
Deshalb war Gold über Jahrhunderte das beste Geld.
Deshalb ist Bitcoin heute die logische Weiterentwicklung:
- digital
- dezentral
- nicht inflationierbar
- global zugänglich
- zensurresistent
Mit freiem Geld funktionieren freie Märkte zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder richtig.
Preise werden ehrlich.
Sparen lohnt sich.
Investitionen werden langfristig.
Politiker verlieren ihre Zauberkräfte.
Reichtum entsteht durch Leistung – nicht durch Zugang zur Geldquelle.
Libertäre sagen deshalb nicht:
„Geld ist böse.“
Sondern:
„Falsches Geld macht alles kaputt.“
Nicht der Kapitalismus hat versagt.
Sondern das Fiatgeld, das sich als Kapitalismus verkleidet hat –
und dabei ganze Gesellschaften in Schuldknechtschaft, Enteignung und Hyperinflation führt.
Die Lösung?
- Freies Geld.
- Freier Markt.
- Freie Menschen.
Und das ist kein Ideal – das ist eine Notwendigkeit.
Mythos 16: „Der Mensch ist zu schlecht für Freiheit“
Behauptung: „Der Mensch ist egoistisch, irrational, aggressiv. Ohne Staat würden die Starken die Schwachen unterdrücken. Deshalb braucht es Regeln, Kontrolle, Führung – kurz: Autorität.“
Fakt: Wenn der Mensch zu schlecht für Freiheit ist, ist er auch zu schlecht für Macht.
Gerade weil Menschen fehlbar sind, darf niemand über andere herrschen.
Freiheit begrenzt Macht – der Staat bündelt sie.
Dieser Mythos klingt fast schon weise.
Er beruft sich auf Menschenkenntnis, Erfahrung, Geschichte.
Und doch ist er eine denklogische Katastrophe.
Denn wer sagt:
„Menschen sind zu schlecht für Freiheit“,
sagt gleichzeitig:
„Deshalb geben wir einigen wenigen Menschen besonders viel Macht – mit Monopol auf Gewalt, Steuern, Bildung, Währung und Recht.“
Moment mal…
Wenn Menschen grundsätzlich gefährlich sind –
warum geben wir einigen eine Uniform, eine Waffe und Immunität?
Das ist, als würde man sagen:
„Wir trauen keinem Menschen, ein Messer zu tragen. Deshalb geben wir einem einzigen Menschen ein Maschinengewehr – und verbieten allen anderen, sich zu wehren.“
Libertäre sagen:
Gerade weil der Mensch unvollkommen ist, muss Macht dezentralisiert werden.
Nicht gebündelt. Nicht monopolisiert. Nicht politisch organisiert.
Stattdessen:
- Eigentumsrechte als Schutzschild
- Verträge statt Erlasse
- Freiwillige Kooperation statt Zwangsverwaltung
- Tausend kleine Einheiten statt ein großes Monstrum
Der Staat ist kein moralisches Wesen.
Er ist nicht die bessere Version des Menschen.
Er ist ein Konstrukt – ein Werkzeug.
Und wie jedes Werkzeug kann er nützlich oder zerstörerisch sein.
Historisch betrachtet war der Staat oft das gefährlichste Werkzeug überhaupt:
- Er hat Kriege geführt – nicht der Markt.
- Er hat Völkermorde organisiert – nicht das Privateigentum.
- Er hat Menschen verfolgt, eingesperrt, mundtot gemacht – nicht der Bäcker um die Ecke.
Deshalb sagen Libertäre:
Wenn du Menschen nicht traust –
dann traue keinem, der über andere herrschen will.
Freiheit bedeutet:
- Du kannst Fehler machen – aber auch daraus lernen.
- Du kannst wählen – und die Konsequenzen tragen.
- Du kannst scheitern – und wieder aufstehen.
Ohne dass jemand dir sagt, wie du zu leben hast.
Kurz:
Freiheit ist nicht gefährlich, weil der Mensch schlecht ist.
Sondern notwendig, weil er es ist.
Mythos 17: „Die Österreichische Schule ist unwissenschaftlich“
Behauptung: „Die Österreichische Schule ist ideologisch, dogmatisch und verweigert sich der empirischen Wissenschaft. Sie betreibt keine echte Ökonomie – sondern Pseudophilosophie.“
Fakt: Die Österreichische Schule arbeitet mit Praxeologie – einer logisch-deduktiven Wissenschaft vom menschlichen Handeln.
Sie ist nicht weniger wissenschaftlich – sondern konsequenter als viele empiristische Modelle, die sich hinter Zahlen verstecken und Ursache und Wirkung verwechseln.
In einer Welt, die von Statistik besessen ist, klingt „empirisch“ wie das höchste wissenschaftliche Gütesiegel.
Wer Tabellen hat, hat recht.
Wer logische Argumente hat, gilt als Dogmatiker.
Doch die Österreichische Schule geht einen anderen Weg – und das ist kein Fehler, sondern ihr größter Beitrag.
Ihr Fundament ist die Praxeologie – die Wissenschaft vom zielgerichteten menschlichen Handeln.
Sie fragt nicht: „Was ist die durchschnittliche Preiselastizität von Zahnpasta in Finnland?“
Sondern:
„Was können wir logisch aus der Tatsache ableiten, dass Menschen handeln?“
Diese Herangehensweise:
- ist deduktiv
- ist widerspruchsfrei
- basiert auf Axiomen (wie: „Menschen handeln“, „Handeln ist zielgerichtet“)
- und kommt zu universell gültigen Aussagen
Beispiele:
- Wenn etwas knapp ist, entstehen Opportunitätskosten.
- Freiwilliger Tausch erzeugt beidseitigen Nutzen.
- Preisdeckel erzeugen Knappheit.
- Geldmengenausweitung führt zu Kaufkraftverlust.
- Eigentumsrechte sind Voraussetzung für geregeltes Wirtschaften.
Das sind keine Theorien zum „Testen“, sondern logische Strukturen, ähnlich wie in Mathematik oder Ethik.
Du testest auch nicht empirisch, ob 2 + 2 = 4 ist – du verstehst es logisch.
Warum lehnen viele Ökonomen das ab?
Weil sie sich in Modellen verlieren, die auf fiktiven Annahmen basieren:
- Homogene Agenten
- Vollständige Information
- „Ceteris paribus“-Konstruktionen
- Mathematische Gleichgewichtsmechanismen
Doch die Realität ist chaotisch, subjektiv, dynamisch.
Und deshalb scheitern makroökonomische Vorhersagen so zuverlässig wie Wetterprognosen im Hochgebirge.
Die Österreichische Schule sagt:
Verstehen statt Vorhersagen.
Sie erklärt die Strukturen, nicht die Schlagzeilen.
Und sie macht transparent, wo andere Modelle bewusst verschleiern – etwa, dass Inflation kein Naturereignis, sondern ein politischer Akt ist.
Fazit:
Die Österreichische Schule ist nicht „unwissenschaftlich“, weil sie keine Regressionsanalyse macht.
Sie ist metawissenschaftlich – sie fragt:
Was ist überhaupt Erkenntnis?
Was ist menschlich möglich?
Wo endet Statistik – und beginnt Verantwortung?
Und genau deshalb wird sie gefürchtet.
Nicht weil sie zu wenig weiß.
Sondern weil sie zu viel hinterfragt.
Mythos 18: „Libertäre verteidigen Kolonialismus und Sklaverei“
Behauptung: „Die Verteidigung von Eigentum und freiem Markt ist in Wahrheit die Verteidigung von Kolonialismus, Enteignung und Ausbeutung. Libertäre verharmlosen Sklaverei, weil sie Besitz über Menschen stellen.“
Fakt: Libertäre stellen den Selbsteigentumsgedanken an erste Stelle: Jeder Mensch gehört sich selbst – deshalb ist Sklaverei die ultimative Verletzung libertärer Ethik.
Kolonialismus basiert auf Gewalt. Libertarismus basiert auf Freiwilligkeit. Es gibt nichts Inkompatibleres.
Dies ist der wohl bösartigste aller Mythen – nicht nur falsch, sondern geradezu umgekehrt.
Die Grundlage libertären Denkens ist das Nicht-Aggressionsprinzip (NAP):
Niemand hat das Recht, einem anderen Gewalt anzutun oder ihn zu beherrschen – außer zur Selbstverteidigung.
Und die logische Konsequenz daraus lautet:
Jeder Mensch ist Eigentümer seines Körpers.
Das heißt:
- Keine Sklaverei
- Keine Zwangsarbeit
- Keine Zwangsimpfungen
- Kein Wehrdienst
- Kein „fürs Gemeinwohl“ zwangsenteigneter Körper, Geist oder Besitz
Libertäre verteidigen Eigentum nur dort, wo es friedlich erworben wurde.
Wer Land durch Kolonialraub oder Sklavenarbeit bekommen hat, hat kein legitimes Eigentum – sondern Diebesgut.
In einer freien Gesellschaft gäbe es Schiedsgerichte und Rückübertragungen, ohne neue Gewaltspiralen.
Und Kolonialismus?
Das war nie Markt – das war immer Staat:
- staatliche Handelsgesellschaften (East India Company mit Monopolprivileg)
- staatliche Armeen
- staatliche Missionierung
- staatlich garantierte Eigentumsansprüche auf fremdem Boden
Marktwirtschaft heißt:
Freiwilliger Austausch.
Kolonialismus heißt:
Waffen, Flotten, Steuern, Unterdrückung.
Und auch heute:
Weltbank, IWF, WTO – das sind keine Märkte, sondern politisch konstruierte Machtinstrumente, die mit libertärem Denken so viel zu tun haben wie ein Steuerbescheid mit einem Geschenk.
Libertäre stehen damit auf der Seite von:
- Sklaven, die sich befreien
- Bauern, die ihr Land behalten
- Völkern, die sich der Zwangsmodernisierung verweigern
- Communities, die eigene Regeln leben wollen – ohne fremde Einmischung
Sie sind radikaler Antikolonialismus – aber ohne neue Kollektivschuld, ohne Opferkult, ohne Umverteilungsfantasien.
Sie sagen nicht: „Du schuldest mir was“ –
sondern:
„Ich lasse dich in Ruhe – und du mich auch.“
Das ist nicht ideologisch – das ist moralisch konsequent.
Und es ist der einzige Weg aus dem ewigen Gewaltkarussell von Beherrschung, Revanche und Rachepolitik.
Mythos 19: „Freiheit nutzt nur den Privilegierten“
Behauptung: „Nur Menschen mit Macht, Geld und Bildung können mit Freiheit etwas anfangen. Alle anderen werden auf dem freien Markt untergehen. Deshalb braucht es einen schützenden Staat.“
Fakt: Freiheit schützt gerade die Schwachen – weil sie die einzige echte Garantie gegen Machtmissbrauch ist.
Nicht Freiheit privilegiert die Reichen – sondern der Staat. Der Markt ermöglicht Aufstieg, der Staat zementiert Verhältnisse.
Dieser Mythos ist besonders zynisch, weil er die Entrechteten benutzt, um ihre Entmündigung zu rechtfertigen.
Er sagt im Grunde:
„Du bist zu schwach, zu arm, zu dumm oder zu abhängig, um dein Leben selbst in die Hand zu nehmen – also übernehme ich das für dich.“
Klingt wie Fürsorge.
Ist aber in Wahrheit: Paternalismus.
Und zwar genau die Sorte, die seit Jahrhunderten Eliten dazu genutzt haben, um ihre Macht mit dem Banner des „Schutzes“ zu legitimieren.
Aber schauen wir auf die Fakten:
Wer profitiert vom Staat?
- Großkonzerne mit Lobbybüros in Berlin und Brüssel.
- Reiche Familien mit Steuerberatern.
- NGOs mit Regierungsverträgen.
- Medien mit GEZ-Garantie.
- Akademiker mit Beamtenstatus.
- Banken mit Zentralbank-Backdoor.
Und wer verliert?
- Kleine Unternehmer, die an Bürokratie scheitern.
- Eltern, die ihre Kinder selbst bilden wollen.
- Landwirte, die an EU-Verordnungen zerbrechen.
- Mieter, die unter Mietendeckeln Wohnungen verlieren.
- Arme, die durch Inflation enteignet werden.
Der Staat schützt nicht die Schwachen.
Er benutzt sie als Begründung, um seine Macht auszubauen – und verteilt dann Brosamen, die er zuvor mit Steuern, Schulden und Druckerpresse eingesammelt hat.
Freiheit dagegen:
- erlaubt Aufstieg
- schützt Minderheiten
- erlaubt eigene Wege
- macht echte Solidarität möglich
- gibt Menschen Würde zurück, weil sie selbst entscheiden dürfen
Wer in einem freien Markt etwas anzubieten hat – sei es eine Dienstleistung, eine Idee, ein Produkt, ein Talent – kann Kunden gewinnen, Einkommen erzielen, sich hocharbeiten.
Und das völlig unabhängig von Herkunft, Klasse oder Parteibuch.
Libertäre sagen daher:
„Du brauchst keinen Fürsprecher – du brauchst das Recht, dein Leben selbst zu gestalten.“
Und ja, Freiheit ist anstrengend.
Aber sie ist die einzige echte Chance auf Gerechtigkeit – nicht durch Gleichmacherei, sondern durch Entfaltung.
Kurz:
- Der Staat lebt von Abhängigkeit.
- Der Markt belohnt Eigenständigkeit.
- Und Freiheit ist die einzige Struktur, die dich nicht zwingt, einem Herrn zu dienen – auch keinem „wohlmeinenden“.
Mythos 20: „Ohne Staat gäbe es Chaos“
Behauptung: „Wenn es keinen Staat gäbe, würde alles zusammenbrechen. Jeder würde nur noch an sich denken. Kriminalität, Anarchie, Bürgerkrieg. Wir brauchen den Staat, um Ordnung zu garantieren.“
Fakt: Das größte Chaos der Geschichte wurde nicht durch zu viel Freiheit ausgelöst – sondern durch zu viel Staat.
Freiwillige Ordnung, Eigentum, Verträge und Gemeinschaften sind robuster als jeder Plan.
Der Staat bringt Stabilität? Sag das mal den Opfern von Inflation, Krieg und Bürokratie.
Es ist ein tiefsitzendes Narrativ:
„Ohne Staat würden die Leute durchdrehen.“
„Der Mensch braucht Kontrolle.“
„Gesetze müssen durchgesetzt werden – sonst gibt’s Mord und Totschlag.“
Aber schauen wir in die Geschichte.
Wer hat die größten Katastrophen angerichtet?
- Die Nazis waren ein Staat.
- Die Sowjetunion war ein Staat.
- Mao, Pol Pot, Assad, Gaddafi – alles Staatschefs.
- Auch der Erste und Zweite Weltkrieg wurden nicht von Bauernmärkten ausgelöst – sondern von Staaten, Bürokratien und Allianzen mit Generalstäben.
Und im Kleinen?
- Staatsmonopole ruinieren Bildung, Gesundheit und Justiz.
- Zentrale Geldpolitik erzeugt Inflation, Schulden, Crashs.
- Bürokratie verhindert Innovation, verzögert Hilfe und schützt Konzerne.
Das ist kein Ausrutscher – das ist systemisch.
Denn Macht zieht Machtmenschen an.
Und Zentralisierung bedeutet: Wenn’s schiefgeht, geht’s für alle schief.
Im Gegensatz dazu:
Dezentralität.
- Wenn eine freiwillige Gemeinschaft versagt, gehen die Leute – oder ändern etwas.
- Wenn ein Anbieter Mist baut, wird er ersetzt.
- Wenn Regeln nicht passen, sucht man sich andere.
- Das ist Wettbewerb – nicht Chaos.
Was viele mit „Chaos“ verwechseln, ist in Wahrheit: Freiheit, die sie nicht kontrollieren können.
Und ja – diese Freiheit ist laut, bunt, unperfekt.
Aber sie ist robust. Sie ist dynamisch. Sie ist menschlich.
Die Österreichische Schule versteht: Ordnung entsteht nicht durch Planung, sondern durch Handeln.
- Der Markt ist kein Chaos – er ist spontane Ordnung.
- Bitcoin ist kein anarchisches Geld – es ist perfekt geregelte Dezentralität.
- Freie Gemeinschaften sind kein Rückfall ins Mittelalter – sie sind die nächste Stufe der Zivilisation.
Oder wie Hayek sagte:
„Die Tatsache, dass wir auf Regeln vertrauen, die wir nicht bewusst erdacht haben, ist keine Schwäche – sondern unsere größte Stärke.“
Fazit:
Staat ist nicht die Abwesenheit von Chaos – sondern oft seine Ursache.
Und Freiheit ist nicht das Problem – sondern die Lösung.
Schlusswort: Warum wir das alles sagen
Wir leben in einer Zeit, in der Freiheit wieder radikal gedacht werden muss.
Nicht als Schlagwort. Nicht als Marketingphrase. Sondern als Prinzip. Als Ethik. Als Struktur für das Zusammenleben freier Menschen.
Die Österreichische Schule, der Libertarismus und der Anarchokapitalismus sind keine Ideologien für Reiche, Nerds oder Prepper. Sie sind Angebote an alle, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen wollen – ohne andere zu unterdrücken.
Was ihre Kritiker meist nicht verstehen:
Libertäre wollen keine Herrschaft. Nicht über Menschen, nicht über Ressourcen, nicht über Narrative.
Sie wollen Frieden durch Freiwilligkeit.
Ordnung durch Eigentum.
Gerechtigkeit durch Dezentralität.
Und Wohlstand durch Verantwortung.
Dieser Text ist kein Angriff.
Er ist eine Einladung:
➤ Zum Nachdenken.
➤ Zum Selberlesen.
➤ Zum Wiederentdecken von Ideen, die nicht rechts, nicht links, sondern einfach nur radikal menschlich sind.
Freiheit funktioniert.
Nicht perfekt – aber besser als alles, was je versucht wurde.
Vor allem: Sie funktioniert ohne Gewalt.
Und das allein macht sie zum gefährlichsten Gedanken unserer Zeit.