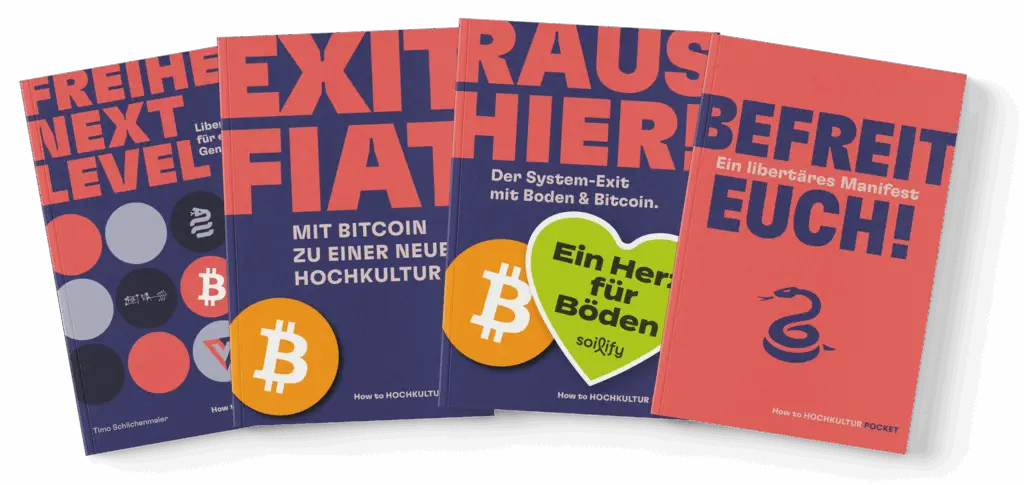1. Freiheit beginnt im Inneren
Für mich ist die Freiheit des Einzelnen nicht verhandelbar. Sie ist keine abstrakte Idee, sondern etwas ganz Konkretes. Etwas, das man spürt, wenn man selbst entscheiden darf. Wenn man Verantwortung übernimmt – für das eigene Leben, das eigene Glück, das eigene Scheitern.
Und wenn das jeder tut, entsteht fast wie von selbst eine funktionierende Gemeinschaft.
Ohne Zwang. Ohne Kontrolle. Einfach, weil es sich richtig anfühlt.
2. Helfen – aus Mitgefühl, nicht aus Zwang
Natürlich gibt es Momente im Leben, in denen man nicht alleine weiterkommt. Krankheit, Krise, Erschöpfung – das kennt jeder. Und genau dann ist es wunderschön zu erleben, dass andere helfen wollen. Aus echtem Herzen. Weil sie können, nicht weil sie müssen.
Wenn Hilfe freiwillig geschieht, wird sie zum Geschenk – für beide Seiten.
3. Zwang ist keine Solidarität
Wenn ich aber gezwungen werde, Dinge zu tun, die mir nicht guttun – „für das große Ganze“ –, dann ist das keine Gemeinschaft, sondern Unterwerfung.
Dann geht es nur einem Teil gut: dem, der seine Vorstellung durchgesetzt hat.
Der Rest bleibt auf der Strecke.
Wäre es nicht natürlicher, wenn jeder selbst wählen darf, in welcher Gemeinschaft, in welcher Stadt, in welchem Lebensstil er sich zu Hause fühlt – solange er die frei gewählten Regeln achtet?
4. Ein globaler Markt macht unsere Bauern kaputt
Ich denke oft an unsere Landwirte. Wie können sie gesund wirtschaften, wenn sie sich mit dem Weltmarkt messen müssen? Wenn sie nicht das anbauen dürfen, was ihre Region wirklich braucht, sondern das produzieren müssen, was irgendwo in der Welt gerade gefragt ist?
Das macht krank – nicht nur die Menschen, auch den Boden, die Tiere, das Klima.
Wir brauchen wieder Märkte, die aus dem echten Leben entstehen.
Natürlich. Regional. Menschlich.
5. Kapitalismus – ein schwieriges Wort
Ich habe die ersten 13 Jahre meines Lebens in der Sowjetunion verbracht. Für mich war Kapitalismus lange ein Schimpfwort. Ich dachte an Ausbeutung, an kalte Fabriken, an arme Arbeiter und reiche Bosse.
Aber später habe ich gelernt: Es gibt einen Unterschied.
Es gibt den kaputten Kapitalismus, wie wir ihn heute oft erleben: staatlich gelenkt, von Konzernen dominiert, mit Gesetzen, die Kleine verdrängen und Große begünstigen.
Und es gibt den freien Markt – lebendig, dezentral, menschlich. Wo Menschen miteinander handeln, weil sie es wollen. Nicht, weil sie es müssen.
Ich sage heute: Kapitalismus ist nicht das Problem.
Das Problem ist der Staat, der ihn kapert – und daraus Korporatismus macht.
6. Freier Markt ist gelebte Beziehung
Ein freier Markt ist nichts Kaltes.
Er ist das, was zwischen Menschen entsteht.
Wenn ich etwas brauche – und du etwas hast – dann tauschen wir.
Manchmal direkt. Manchmal mit Geld.
Nicht weil jemand es befiehlt, sondern weil es für uns beide Sinn ergibt.
7. Was ist Hochkultur wirklich?
Viele sprechen von „hohen“ und „niedrigen“ Kulturen.
Ich finde diesen Gedanken falsch.
Jeder Mensch soll so leben, wie es zu ihm passt.
Aber eine wirklich hohe Kultur – oder sagen wir: echte Hochkultur – erkennt man an einem einfachen Prinzip:
Sie hält keine Sklaven.
Keine Sklaven wie im alten Rom.
Keine Kolonialvölker.
Und auch keine modernen Zwangsarbeiter in Europas Steuersystem – finanziell ausgepresst, abhängig von einem kaputten Geldsystem, das von Dollar-Imperien kontrolliert wird.
Echte Hochkultur heißt: Freiheit in allen Bereichen.
Wirtschaftlich, spirituell, menschlich.
Nicht als Utopie.
Sondern als Realität, die wir gestalten – durch unser Leben, unser Handeln, unsere Geschichten.