Stell dir vor, du wachst morgens auf – und plötzlich sind 25 % deiner Nachbarn keine Demokraten mehr.
Nicht, weil sie Bomben bauen. Nicht, weil sie irgendwem etwas getan haben. Sondern weil ein Geheimdienst, den du weder gewählt noch je zu Gesicht bekommen hast, beschlossen hat:
„Diese Leute sind jetzt offiziell gefährlich.“
Ohne Urteil. Ohne Beweise. Ohne Widerspruch.
Nur mit Stempel: „Gesichert rechtsextrem.“
Willkommen in der Verteidigung der Demokratie. Mit allen Mitteln. Auch den undemokratischen.
Wer heute in Deutschland die falsche Meinung hat, wird nicht mehr widerlegt –
er wird beobachtet.
Wer den falschen Link teilt, landet nicht im Diskurs –
sondern auf dem Schirm.
Wer die falsche Partei wählt, ist kein Gesprächspartner –
sondern ein Feind.
Und weil das Land schon seit Corona auf Krawall gebürstet ist, fällt es kaum noch auf:
Dass Demokratie hier gerade nicht gegen ihre Feinde verteidigt wird,
sondern gegen das eigene Volk.
Und keiner schreit – weil alle Angst haben, auf der falschen Seite zu stehen
Stell dir vor, du bist Lehrer.
Du hast vielleicht die AfD gewählt. Nicht aus Hass. Nicht aus Ideologie.
Sondern weil du denkst: „Die da oben hören sowieso nicht mehr zu.“
Und dann bekommst du Post.
Von der Schulaufsicht.
Du wirst überprüft.
Du wirst abgezogen.
Du bist untragbar.
Nicht, weil du schlecht unterrichtet hättest.
Sondern weil du dich politisch falsch bewegt hast.
Herzlichen Glückwunsch: Du lebst in einer Demokratie. Aber nur, solange du dich nicht bemerkbar machst.
Spaltung ist kein Unfall. Sie ist das Betriebssystem.
Seit Corona geht alles nur noch in eine Richtung: Teile und herrsche.
Die einen tragen Maske, die anderen tragen Schuld (sind gar Tyrannen).
Die einen sind klimaneutral, die anderen klimaschädlich.
Die einen stehen mit der Ukraine, die anderen mit Putin (ob sie wollen oder nicht).
Und jetzt: Die einen sind Demokraten. Die anderen „Rechtsextreme“. Ganz offiziell.
Die neuen Ketten sind nicht aus Eisen. Sie sind aus Etiketten.
Und wer nicht dazugehören will, wird eben aussortiert.
Ganz demokratisch, versteht sich.
Was macht das mit uns als Gesellschaft?
Es macht uns müde.
Misstrauisch.
Wütend.
Still.
Es macht, dass Menschen nicht mehr miteinander reden – weil sie Angst haben, sich zu verlieren.
Es macht, dass Familien zerbrechen, Freundschaften einfrieren, Nachbarn schweigen.
Und genau das ist gewollt.
Denn wer getrennt ist, lässt sich besser beherrschen.
Wer sich nicht mehr vertraut, braucht den Staat.
Und wer Angst hat, hat keine Kraft mehr, zu widersprechen.
Und die größte Frage bleibt: Ist das alles Absicht – oder nur Dummheit?
Wenn man 25 % der Bevölkerung aus der Debatte drängt – will man da wirklich Frieden?
Wenn man jeden Kritiker als Gefahr einstuft – will man da wirklich Demokratie?
Oder ist das alles nur ein großer Reflex:
Die Macht klammert sich an sich selbst.
Wie ein Ertrinkender, der nicht merkt, dass er die anderen mit in die Tiefe reißt.
Die Wahrheit ist: Wir wissen es nicht.
Wir wissen nur:
Beides – Absicht oder Dummheit – ist gefährlich.
Und beides zerstört das, was sie angeblich schützen wollen.
Was bleibt?
Nicht viel. Aber genug.
Ein paar klare Gedanken.
Eine Entscheidung: Nicht mitmachen.
Eine Vision: Raus hier.
Und ein Werkzeug: Bitcoin.
Denn während sie sich weiter an den Begriff „Demokratie“ klammern wie an eine leere Flasche im Sturm, bauen wir etwas Neues.
Freiwillig. Dezentral. Friedlich.
Keine Parteien. Kein Verfassungsschutz. Keine Gutachten. Nur Menschen. Und Verantwortung.
Und vielleicht… ist das die gute Nachricht.
Vielleicht muss das Alte so laut untergehen,
damit das Neue in Ruhe entstehen kann.
Nicht im Streit. Nicht im Hass.
Sondern im Gespräch. In Gemeinschaft. Im Vertrauen.
Denn dort, wo der Staat das Miteinander zerstört,
wachsen neue Verbindungen.
Dort, wo er spaltet, entsteht Nähe – außerhalb seiner Reichweite.
Dort, wo Kontrolle herrscht, keimt Selbstverantwortung.
Die Spaltung ist real.
Aber wir müssen nicht Teil davon sein.
Wir wählen das andere Prinzip: Verbindung.
Wir wählen Dialog statt Urteil.
Freiheit statt Feindbilder.
Und einen friedlichen Exit aus einem System, das sich selbst überlebt hat.
Wer spalten will, verliert.
Wer verbindet, gewinnt.
Und vielleicht ist genau das
die wahre Revolution.


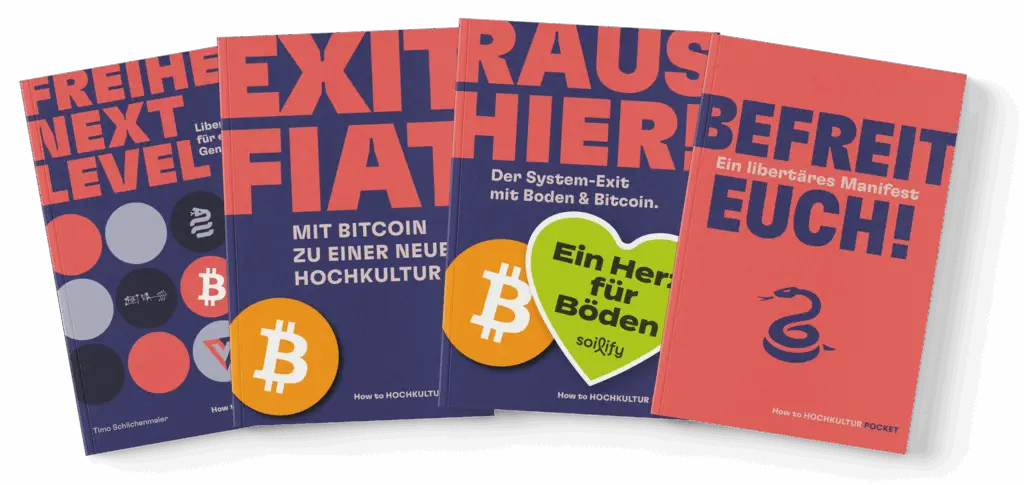



2 Antworten
Ein paar schnelle Anmerkungen:
– Unbelegte Zahl: Woher kommt die Behauptung, 25 % der Bürger seien „gesichert rechtsextrem“? Ohne Quellen wirkt das willkürlich und reißerisch.
– Alarmistischer Ton: Durch permanente „Wir gegen die“-Sprachmuster wird der Eindruck künstlicher Feindschaft geschürt statt konstruktiver Diskussion.
– Fehlende Differenzierung: Es wird nicht zwischen konkreten Extremismus-Fällen und legitimer Kritik unterschieden – das ist methodisch unzulässig.
– Stilbruch Produktwerbung: Die plötzliche Werbung für Bücher und Bitcoin wirkt wie ein versteckter Werbe-Claim und untergräbt die Ernsthaftigkeit des Essays.
In Summe: Mehr Fakten, weniger Dramatisierung, klare Quellenangaben – dann kann die Debatte wirklich weiterkommen.
Danke für deinen Kommentar und die kritischen Anmerkungen!
Wir freuen uns immer über Feedback, gerade weil unser Essay bewusst provokant und zugespitzt formuliert ist.
💡 Ein paar Gedanken dazu:
1. „25 % gesichert rechtsextrem“:
Guter Punkt – die Zahl war eher symbolisch gemeint, um die paradoxe Situation aufzuzeigen: Wenn man eine Partei pauschal als „gesichert rechtsextrem“ einstuft und dabei vergisst, dass sie in manchen Regionen über 30 % der Stimmen holt, muss man sich fragen: Wer entscheidet hier eigentlich, was demokratisch ist?
Die Zahl an sich ist weniger eine statistische Angabe, sondern ein Fingerzeig darauf, dass hier ein großer Teil der Bevölkerung plötzlich als „Problem“ markiert wird.
2. „Alarmistischer Ton und Wir-gegen-die-Rhetorik“:
Ja, absolut! Der Essay ist satirisch und sarkastisch gemeint – weil wir die offizielle Kommunikation selbst als alarmistisch empfinden. Wenn eine Behörde so pauschal politische Gegner kategorisiert, darf auch die Reaktion mal drastisch und ironisch ausfallen.
Der „Wir-gegen-die“-Ton ist dabei ein bewusster Stilgriff, um auf die Spaltungspolitik hinzuweisen – nicht um Menschen noch weiter auseinanderzutreiben.
3. „Fehlende Differenzierung zwischen Extremismus und Kritik“:
Das ist ein wichtiger Punkt. Aber gerade hier liegt die Krux: Die staatliche Argumentation differenziert selbst nicht. Ein ganzer Parteiapparat wird mit einem Label versehen – und das hat drastische Konsequenzen. Genau diesen pauschalen Umgang kritisieren wir.
Unser Anliegen: Wie können wir noch frei reden, wenn jede Systemkritik direkt mit Extremismus gleichgesetzt wird?
4. „Stilbruch durch Produktwerbung (Bücher/Bitcoin):“
Ja, kann man so sehen! 😉
Aber ganz ehrlich: Unsere Arbeit finanziert sich nicht von selbst.
Wir stehen zu unseren Ideen, und dazu gehört auch die Vision von Selbstverantwortung und Freiheit durch Bitcoin. Und ja – wir schreiben Bücher darüber.
Am Ende ist der Essay auch eine Einladung zum Mitdenken – und wer Lust hat, mehr zu erfahren, darf sich gerne durch unsere Inhalte klicken.
Provokation muss nicht jedem gefallen. Wir verstehen das.
Aber manchmal braucht es auch mal einen Text, der den Finger in die Wunde legt – gerade wenn eine staatliche Institution im Namen der Demokratie zu Mitteln greift, die man eher aus autoritären Systemen kennt.
Trotzdem: Danke, dass du dich damit auseinandergesetzt hast!
Der Diskurs lebt von verschiedenen Perspektiven – und dein Kommentar zeigt, dass wir zumindest nicht ignoriert werden. 😉
Beste Grüße,
Dein How to HOCHKULTUR-Team