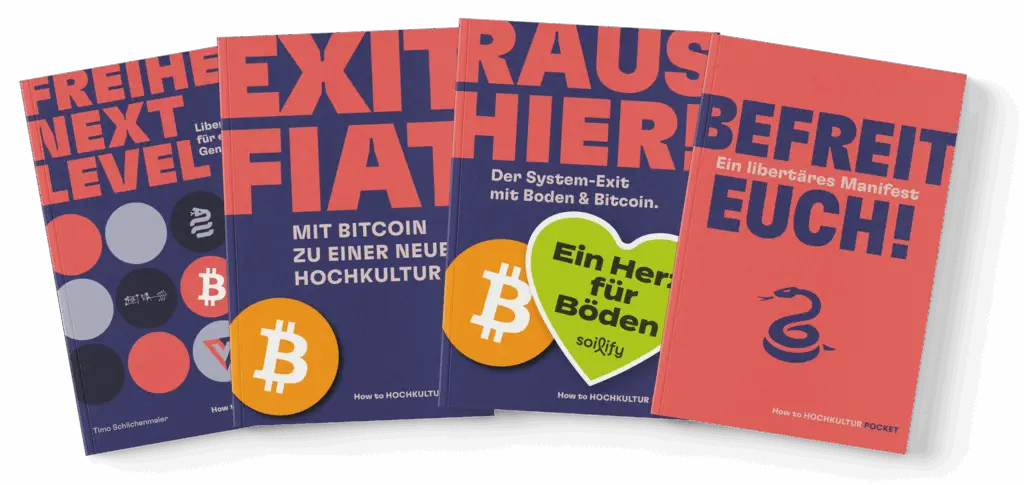Warum man Massentierhaltung nicht abschaffen kann, ohne auch den Ackerbau zu hinterfragen
Ein schlechtes Jahr, ein systemisches Problem
2025 war kein gutes Jahr für den Ackerbau.
Der Regen kam zu spät, die Sonne zu selten, die Erträge blieben unterdurchschnittlich. Vor allem die Qualität des Getreides machte Probleme: zu wenig Eiweiß, keine Backfähigkeit – als Lebensmittel ungeeignet.
Was nun? Der Markt für Futtergetreide bleibt die einzige Rettung. Wer Tiere hält, nimmt auch das schwache Korn. Nicht zum vollen Preis, aber immerhin. Ein Notausgang, der für viele Betriebe überlebenswichtig ist.
Genau dieser Notausgang jedoch steht unter Beschuss. In der öffentlichen Debatte wird die Tierhaltung zum Feindbild erklärt – am besten ganz abschaffen, sagen viele. Kühe raus, Schweine raus, Hühner raus. Aber wer kauft dann das Getreide, das nicht zum Brot taugt? Wer verwertet die Ernte, wenn das Wetter nicht mitspielt? Wer schließt die Lücke zwischen Ideal und Realität?
Die Antwort ist unbequem: Niemand.
Der Trog ist kein Ausweg, sondern Systembestandteil
Denn Ackerbau und Tierhaltung sind kein Gegensatz. Sie sind zwei Seiten desselben ökonomischen Kreislaufs. Der Acker produziert nicht nur Lebensmittel für den Menschen, sondern in weiten Teilen das, was in Jahren mit schlechter Qualität – oder schlicht aufgrund der Natur – nur für Tiere brauchbar ist. Und das ist keine Ausnahme, sondern die Regel.
Ein Großteil der Getreideproduktion – je nach Quelle zwischen 40 und 60 Prozent – landet nicht auf Tellern, sondern in Trögen. Tiere sind nicht nur Nahrung, sie sind auch Verwerter. Sie übernehmen das, was der Mensch nicht essen kann oder will. Ohne sie fehlen Absatzmärkte, Verwertungspfade, Notfallpläne. Und die wirtschaftliche Grundlage für große Teile des Pflanzenbaus.
Veganismus als ökonomische Illusion
Die Forderung, Tierhaltung abzuschaffen, ignoriert diesen Zusammenhang. Sie klingt gut auf Instagram, macht sich gut in Broschüren – scheitert aber an der Realität auf dem Acker. Denn Landwirtschaft ist keine moralische Idee. Sie ist ein ökonomischer Prozess. Und der folgt, ob man will oder nicht, gewissen Regeln.
Die wichtigste lautet: Ich muss mehr rausholen, als ich reinstecke. Kein Unternehmer, kein Bauer, kein Mensch wirtschaftet dauerhaft mit Verlust – außer er wird dafür bezahlt oder betrogen. Und genau hier liegt das Problem eines vollständig veganisierten Systems: Es produziert strukturell unter Wert.
Mehr Ackerbau = weniger Effizienz
Getreide lässt sich nicht zu hundert Prozent für die menschliche Ernährung nutzen. Ein erheblicher Teil ist Ausschuss, Überproduktion oder schlicht mangelhaft. In einem gemischten System wird dieser Teil von Tieren verwertet. Ohne Tiere bleibt er wertlos. Das bedeutet: gleich hoher Input – deutlich weniger Output. Mehr Arbeit, weniger Nutzen. Und genau das ist es, was die Österreichische Schule als Ressourcenfehlallokation bezeichnet.
Der Versuch, die Tierhaltung zu verbannen und durch mehr Ackerbau zu ersetzen, führt damit nicht zu mehr Effizienz, sondern zu mehr Verschwendung.
Wenn Grünland in Sojafeld verwandelt wird
Besonders fatal wird es, wenn sogar Grünland – also Flächen, die ausschließlich mit Weidetieren sinnvoll genutzt werden können – in Ackerland umgewandelt wird, um dort Soja, Weizen oder Erbsenproteine für vegane Produkte anzubauen. Das Ergebnis: hoher Energieaufwand, hoher Ressourcenverbrauch, geringe Nährstoffdichte – und ein System, das ohne Subventionen nicht lebensfähig ist.
Ein rein pflanzliches Ernährungssystem braucht industrielle Strukturen, globalisierte Lieferketten, chemischen Input und ein hohes Maß an politischer Steuerung. Es mag moralisch besser erscheinen – ökonomisch ist es ein Rückschritt.
Die Tiere verdrängen heißt den Kreislauf zerstören
Die Tiere vom Feld zu verdrängen bedeutet nicht, die Probleme zu lösen, sondern sie zu verschieben. Denn die Kalorien, die sie heute aus Gras, Schalen, Blättern und minderwertigem Getreide erzeugen, müssen morgen aus hochgezüchteten Spezialkulturen kommen – mit all den bekannten Folgen: Erosion, Monotonie, Abhängigkeit von synthetischen Betriebsmitteln. Die Rechnung geht nicht auf.
Die Alternative heißt Weide
Der einzig sinnvolle Weg ist daher nicht die Abschaffung der Tierhaltung, sondern ihre Rückführung in natürliche, dezentrale Kreisläufe. Rinder auf der Weide, Hühner auf dem Hof, Schweine im Wald. Tierhaltung ohne Kraftfutter, ohne Stallzwang, ohne globale Futtermittelimporte – aber mit Sinn.
Weidetierhaltung funktioniert auch dann, wenn der Ackerbau versagt. Sie braucht keine Hochleistungsrationen, keine Sojapellets, keine fossile Unterstützung. Sie braucht nur Fläche, Zeit und Wissen. Und sie produziert das, was kein Labor der Welt ersetzen kann: Wert.
Rechnen statt retten
Massentierhaltung ist nicht Ursache des Problems, sondern Symptom eines Systems, das zu viel produziert – weil es glaubt, damit moralisch auf der richtigen Seite zu stehen. Doch Ethik ohne Ökonomie ist Ideologie. Und Landwirtschaft ohne ökonomisches Denken ist nichts weiter als betreutes Scheitern.
Wer also wirklich etwas verändern will, muss anfangen zu rechnen. Nicht nur in Kalorien oder CO₂, sondern in echten Zusammenhängen: Was entsteht? Was bleibt? Was trägt?
Denn wer weniger rausbekommt, als er reinsteckt, zerstört am Ende genau das, was er retten will: Boden, Bauern, Gesellschaft.