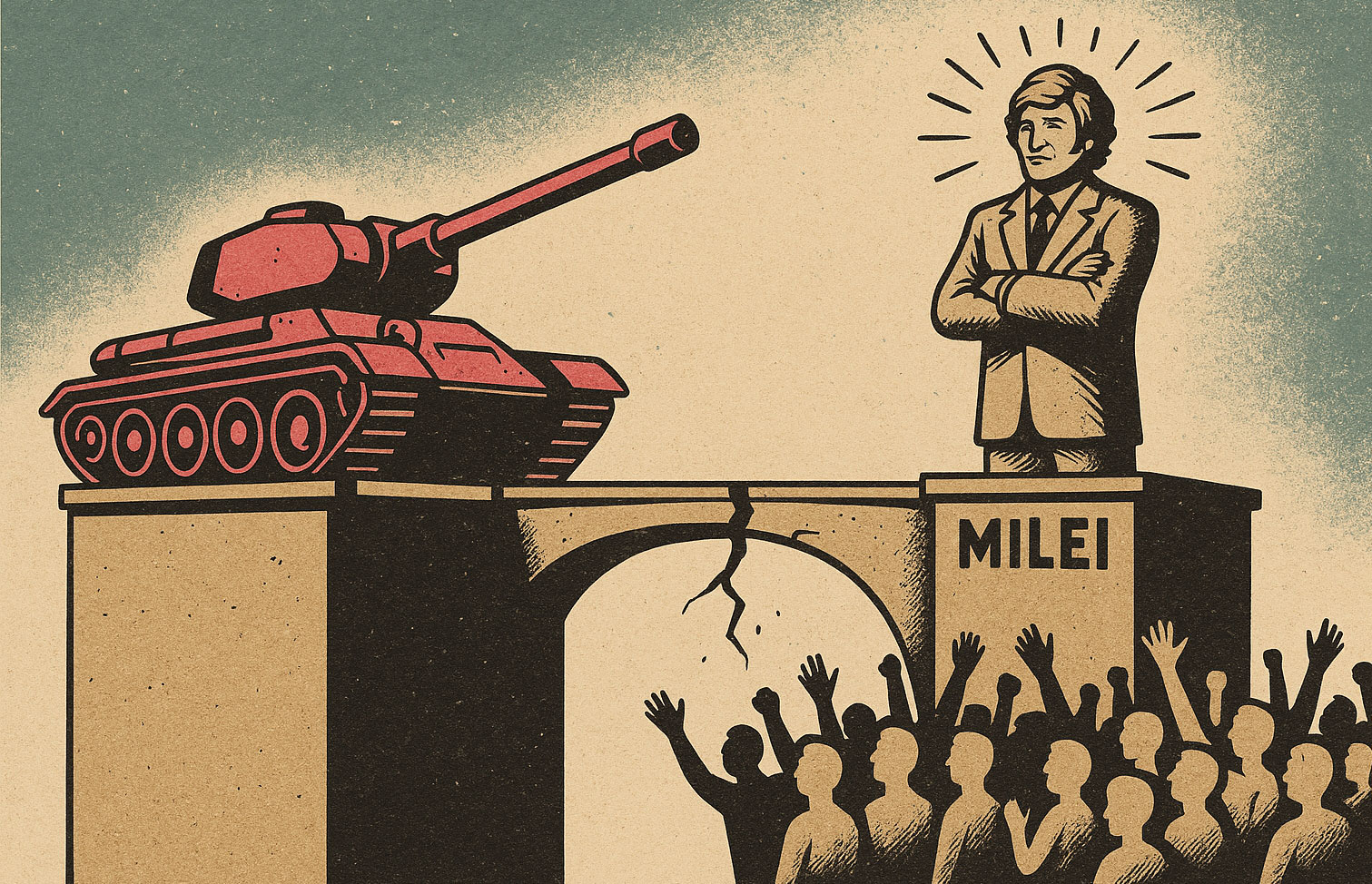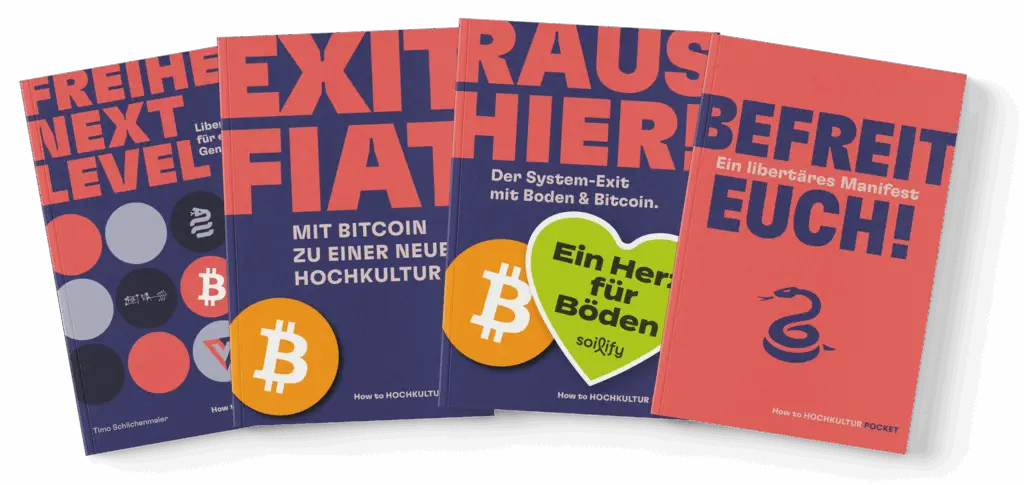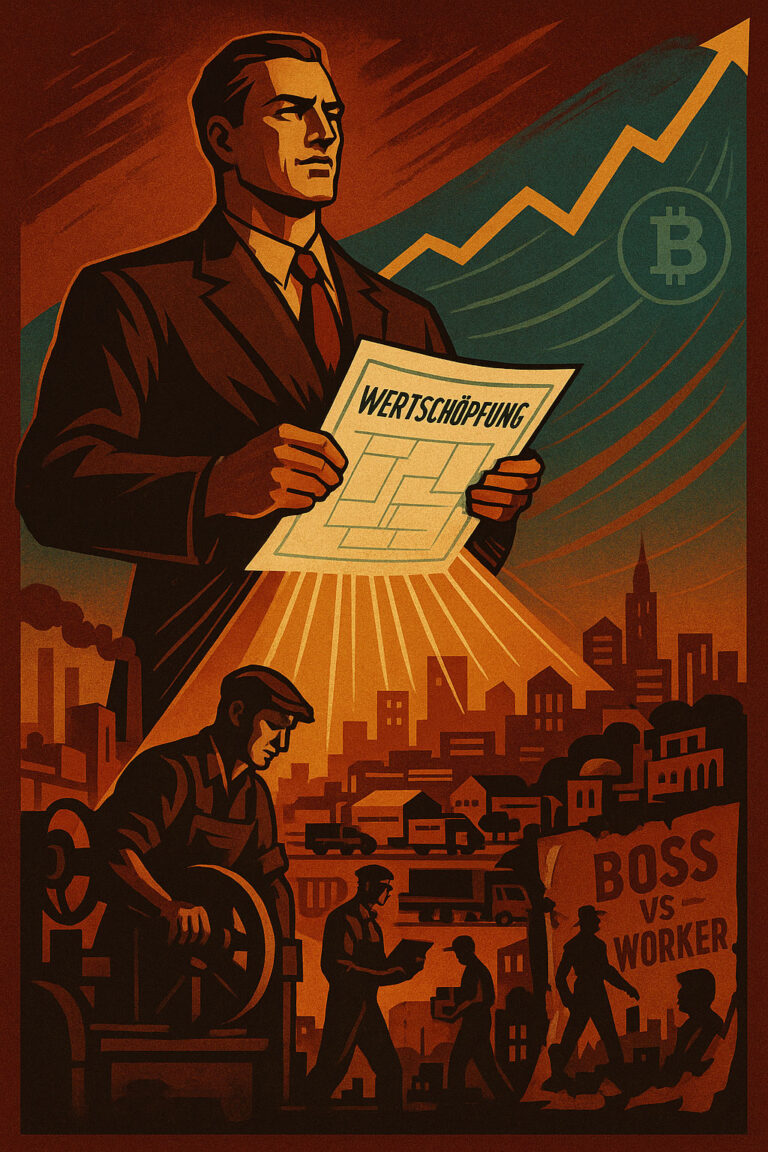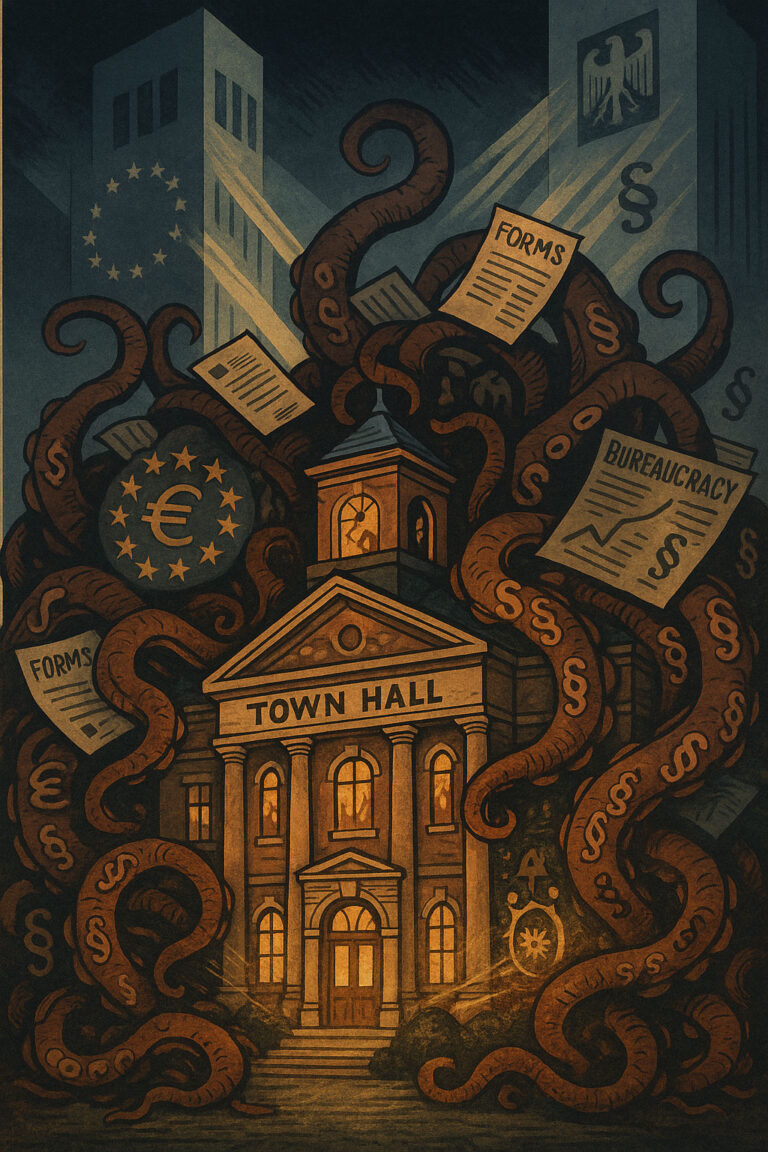Die libertäre Bewegung in Deutschland erlebt gerade eine Zerreißprobe. Ausgangspunkt ist die Entscheidung des Mises-Instituts Deutschland, dem argentinischen Präsidenten Javier Milei einen Preis zu verleihen. Was eigentlich als Ehrung gedacht war, führte zum Eklat: Hans-Hermann Hoppe, Guido Hülsmann und Peter Puster sind aus Protest aus dem Institut ausgetreten.
Ihre Begründung: Milei sei kein echter Libertärer. Ein Populist, der große Worte schwingt, aber in der Realität wenig oder gar das Gegenteil umsetzt. Auf der anderen Seite stehen jene, die ihn verteidigen: Milei könne nicht von Tag eins an die Zentralbank sprengen, Argentinien brauche Zeit, Strategie, Zwischenschritte.
In diese aufgeheizte Lage platzierte Andreas Tank, alias „der rosarote Panzer“, seine Kritik – hart, zugespitzt, für viele zu aggressiv. Seine Aussagen über Milei provozierten nicht nur Debatte, sondern Entrüstung. Und plötzlich ging es weniger um Milei selbst, sondern um die Frage: Wie gehen Libertäre miteinander um, wenn sie uneins sind?
Zwischen Heldenverehrung und Feindschaft
Die Szene spaltet sich nun in zwei Lager:
Die einen lehnen Milei plötzlich völlig ab, weil sie Tanks harte Worte übernehmen.
Die anderen lehnen Tank ab, weil sie seine Aggressivität unerträglich finden.
Das Ergebnis: ein Konflikt, der nicht mehr über Inhalte geführt wird, sondern über Loyalitäten. Es geht nicht mehr um Argumente, sondern um Freund oder Feind.
Viele, darunter auch Benjamin Mudlack, blicken mit Sorge auf diese Entwicklung. Denn was gerade geschieht, ist weniger ein politischer Streit – es ist eine innere Krise. Eine Bewegung, die eigentlich für Respekt, Vielfalt und Freiheit stehen will, zerreibt sich in einem Bekenntniskampf.
Jung: Der Archetyp des Retters
C. G. Jung hätte diesen Streit sofort als archetypisches Muster erkannt. In Zeiten der Krise tritt im kollektiven Unbewussten der Archetyp des „Retters“ hervor. Menschen projizieren ihre Sehnsucht nach Ordnung, Sinn und Erlösung auf eine Person. Der Politiker wird zum Symbol, zum Heilsbringer.
Kritik an dieser Figur wirkt dann wie Blasphemie. Doch wenn die Kritik – wie im Fall Tank – mit scharfen, fast vernichtenden Worten kommt, kippt die Projektion ins Gegenteil: Der Retter wird zum Verräter, der Kritiker zum Feind. Die Archetypen wechseln, aber die Dynamik bleibt dieselbe: ein Spiel aus Verehrung und Verdammung.
Reich: Die emotionale Pest
Wilhelm Reich hätte darin die emotionale Pest erkannt: das Unvermögen, mit Kritik und Differenz konstruktiv umzugehen. Statt Argumente zu prüfen, reagieren Menschen mit Abwehr, Aggression oder Tabuisierung.
Für Reich waren das Symptome einer Gesellschaft, die unterdrückt und blockiert ist – unfähig zur Selbstregulierung. Was wir heute sehen, ist genau das:
Heldenverehrung auf der einen Seite.
Aggressive Verdammung auf der anderen.
Kaum Raum für nüchterne Analyse, noch weniger für Selbstreflexion.
Was bedeutet Freiheit wirklich?
Genau hier zeigt sich ein blinder Fleck: Viele Libertäre definieren Freiheit rein politisch oder ökonomisch – weniger Staat, weniger Steuern, mehr Markt. Aber die eigentliche Probe für eine freiheitliche Kultur ist der Umgang mit Konflikten.
Können wir Kritik aushalten, ohne in Feindschaft zu verfallen?
Können wir eine Figur wie Milei differenziert sehen – weder als Messias noch als Dämon?
Können wir uns gegenseitig respektieren, auch wenn wir unterschiedliche Strategien sehen?
Freiheit heißt nicht, dass alle einer Meinung sind. Freiheit heißt, dass unterschiedliche Meinungen nebeneinander bestehen können – ohne dass eine Bewegung daran zerbricht.
Hochkultur: Freiheit ohne neue Dogmen
Wir bei Hochkultur sagen: Genau hier entscheidet sich, ob Libertarismus wirklich frei macht – oder ob er nur ein neues Dogma ist.
Jung zeigt uns, wie gefährlich die Archetypen sind, wenn wir sie unbewusst ausleben.
Reich zeigt uns, wie Kritikunfähigkeit und Tabus eine Szene von innen zersetzen.
Wenn Libertäre sich heute über Milei zerstreiten, dann ist das eine Chance zur Selbstreflexion. Denn der wahre Feind ist nicht Milei, nicht Tank, nicht der jeweilige Gegner im Streit. Der wahre Feind ist das alte Muster: die Unfähigkeit, Kritik und Vielfalt auszuhalten.
Fazit: Freiheit heißt, Kritik zu ertragen – auch wenn sie scharf ist.
Freiheit heißt, Helden vom Sockel zu holen – ohne neue drauf zu setzen.
Freiheit heißt, Tabus zu durchbrechen – auch im Umgang miteinander.
Nur so wird aus einer Bewegung, die jetzt in Spaltungen droht zu versinken, eine Kultur echter Freiheit.
Es lohnt sich trotzallem, sich dieses Video zum Thema Milei anzuschauen: