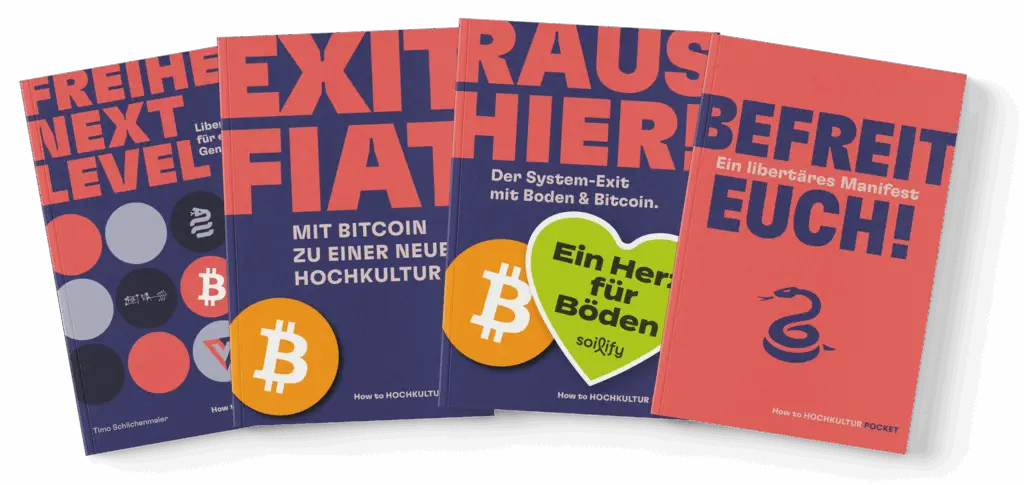Jeder kennt Monopoly. Manche lieben es, viele hassen es – und nicht wenige Freundschaften sind daran zerbrochen. Doch was wäre, wenn das Spiel ganz anders hätte laufen können? Wenn Monopoly nicht nur ein Lehrstück über Monopole und Zwangsmieten wäre, sondern auch eine Alternative geboten hätte?
Tatsächlich war das ursprüngliche Monopoly, damals noch The Landlord’s Game, nie als reines Strategiespiel gedacht, sondern als wirtschaftspolitisches Lehrmittel. Und es hatte nicht nur ein, sondern zwei Regelsets:
- Das Monopoly-Regelset, das jeder kennt: Hier gewinnt der Spieler, der alle anderen in die Pleite treibt.
- Ein fast vergessenes Prosperity-Regelset, das auf Zusammenarbeit und gemeinsame Wohlstandssteigerung setzt.
Beide sollten zeigen, wie sich wirtschaftliche Systeme unterschiedlich auf die Spieler auswirken. Doch als die Parker Brothers das Spiel übernahmen, verschwand die „Prosperity“-Version – und mit ihr die Lektion über verschiedene Wirtschaftsmodelle.
Elizabeth Magie und die Idee hinter Monopoly
Die Schöpferin des Spiels, Elizabeth Magie, war eine Anhängerin von Henry George, einem Ökonomen des späten 19. Jahrhunderts, der die Idee einer einzigen Steuer auf Landbesitz (Single Tax) propagierte. George argumentierte, dass Landbesitz per se nicht produktiv sei und dass Grundbesitz-Einnahmen eher Monopolgewinne als echte Wertschöpfung darstellten. Magie wollte mit The Landlord’s Game zeigen, wie sich wirtschaftliche Regeln auf Wohlstand und Ungleichheit auswirken – je nach Spielweise.
Doch statt einer tiefgehenden Debatte über Wirtschaftssysteme setzte sich nur die Regelvariante durch, die den brutalen Konkurrenzkampf betont. Das ist ironisch, denn das Spiel zeigt damit eine Karikatur des Kapitalismus: einen künstlichen Markt, in dem Monopole durch Zwangsmieten und fehlenden Wettbewerb unvermeidlich werden.
Prosperity: Ein utopisches Spiel oder Sozialismus in Reinform?
Das alternative Prosperity-Regelset funktionierte anders:
- Jedes Mal, wenn ein Spieler eine Immobilie erwirbt, profitieren alle.
- Das Spiel endet erst, wenn der ärmste Spieler seinen Wohlstand verdoppelt hat – dann gewinnen alle gemeinsam.
Das klingt nach einer netten Utopie, hat aber einen entscheidenden Fehler: Es schafft kaum Anreize für unternehmerisches Handeln. Wer Immobilien kauft, generiert Wohlstand für alle, aber es gibt keine echte Konkurrenz, kein unternehmerisches Risiko und keine Anreize, wirklich innovativ zu sein. Die Lektion? Wenn alle automatisch von den Erfolgen anderer profitieren, verschwimmen die Unterschiede zwischen freiwilliger Kooperation und Zwangsumverteilung.
Libertäre würden hier einwenden: Wohlstand entsteht nicht durch zentral geplante Gleichverteilung, sondern durch produktive Arbeit, freiwilligen Handel und Wettbewerb. Das Prosperity-Regelset ist daher nicht nur unrealistisch, sondern auch eine Simulation sozialistischer Wunschträume.
Monopoly als Karikatur des Kapitalismus
Ironischerweise zeigt das überlebende Regelset von Monopoly nicht den echten freien Markt, sondern ein verzerrtes Bild:
- Es gibt kein echtes Unternehmertum – nur Glück und aggressiven Grundstückserwerb.
- Es gibt keine Innovationen oder Alternativen zum Mieten-System.
- Der Markt ist stark reguliert: Ein begrenztes Spielfeld, keine neuen Geschäftsideen, keine Alternativen zum Besitz von Immobilien.
Der Kapitalismus in einem freien Markt basiert aber nicht auf Zwangsmonopolen, sondern auf Innovation, Dezentralisierung und freiwilligem Handel. Wer in einem echten freien Markt zu teuer vermietet, wird durch Konkurrenz herausgefordert. Wer langfristig erfolgreich sein will, muss Werte schaffen – nicht nur Land besitzen.
Wie sähe ein libertäres Regelset aus?
Statt sich zwischen brutalen Monopolen und kollektivistischer Umverteilung zu entscheiden, könnte ein drittes Regelset ein realistisches, libertäres Wirtschaftsmodell abbilden. Hier einige Mechanismen, die ein „Free Market“-Spiel enthalten müsste:
1. Freie Preisbildung und Wettbewerb
- Spieler können Unternehmen gründen, Dienstleistungen anbieten oder Märkte erschließen.
- Mieten entstehen nicht automatisch, sondern durch Verhandlungen und Vertragsfreiheit.
Statt eines einzigen Spielmechanismus (Grundstück kaufen, Miete kassieren) gibt es flexible Geschäftsmodelle.
2. Kapitalbildung und Innovation
- Wer langfristig investiert (statt nur zu spekulieren), kann nachhaltige Vorteile erlangen.
- Technologie- und Infrastruktur-Verbesserungen bringen strategische Vorteile.
- Statt „Glück“ in Form von Würfeln könnte es mehr unternehmerische Entscheidungsmöglichkeiten geben.
3. Kein erzwungener Staat, sondern freiwillige Gemeinschaften
- Es gibt keine zentral erhobenen Steuern oder Vorschriften – Spieler können jedoch freiwillig für kollektive Projekte zahlen (z. B. Straßenbau, Sicherheitsdienste).
- Anstatt eines festgelegten Systems entstehen Märkte und Strukturen durch das Spielgeschehen.
4. Dezentralisierte Wirtschaft
- Spieler können sich spezialisieren, regionale Handelszonen erschaffen oder alternative Währungen nutzen.
- Konkurrenz sorgt dafür, dass kein Spieler unaufhaltsame Monopole aufbauen kann – neue Spieler können sich in den Markt einbringen.
Fazit: Monopoly ist nicht der freie Markt – aber es ist eine wertvolle Lektion
Die Geschichte von The Landlord’s Game zeigt, wie unterschiedlich Wirtschaftssysteme wahrgenommen werden können – und wie sehr es darauf ankommt, welche Anreize in einem System gesetzt werden.
- Monopoly zeigt eine Karikatur des Kapitalismus, in der Monopole unvermeidbar sind.
- Prosperity stellt eine idealisierte kollektivistische Utopie dar, die wirtschaftliche Anreize ignoriert.
- Ein libertäres Wirtschaftsspiel müsste einen dritten Weg gehen: freiwilliger Handel, Unternehmertum und natürliche Marktdynamiken statt zentraler Kontrolle oder monopolistischer Enge.
Vielleicht ist es an der Zeit für ein neues Spiel – eines, das zeigt, wie echte wirtschaftliche Freiheit funktioniert. Bis dahin bleibt Monopoly ein ungewollt gutes Beispiel für die Fehler eines falschen Kapitalismus. Wer wirklich verstehen will, wie Wohlstand entsteht, sollte sich nicht mit fiktiven Monopolen zufriedengeben, sondern nach echten, freiwilligen Lösungen suchen.